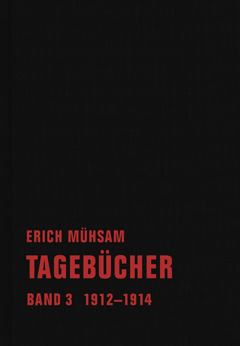X.
27. Juni – 17. Oktober 1912
S. 1300 – 1443
München, Donnerstag, d. 27. Juni 1912.
Heut habe ich wieder zwei Stunden im Stefanie vergebens auf Jenny gewartet. Da sie nicht kam, scheint mir der ganze Tag verloren und ich bin übler Laune. Die muß ich benutzen, um endlich die Texte unter die Zeichnungen zu machen, die mir Geheeb mitgegeben hat. Bei guter Stimmung fallen mir bestellte Witze nie ein. Die müssen herausgequält werden. – Es stehen üble Zeiten bevor. Die Rechnung am 1. Juli wird in der Pension ziemlich hoch sein, und, wenn nicht wenigstens der „Simplizissimus“ gleich wieder etwas zahlt, kann ich schon mit einem Defizit vom ersten Tage an rechnen. Auf Gotthelf setze ich nicht viel Hoffnungen und mit dem Dreimasken-Verlag wird es wohl endgiltig aus sein. Auf der Kegelbahn sprach ich gestern mit Rehse, er will bei Georg Müller antippen, ob der vielleicht das Essaybuch herausgeben will. Ich habe sehr wenig Zutrauen. Auch das „Tagebuch a. d. Gefängnis“ werde ich weiterhin zu plazieren versuchen. Aber ich rechne auch da im voraus mit meinem gewohnten Pech. Wie ich die Dinge immer drehe und ansehe, es bleibt immer wieder ausschließlich der eine Ausweg, den ich nicht beschleunigen kann und auf den ich geduldig warten muß: die Katastrophe in Lübeck.
München, Freitag d. 28. Juni 1912.
Bewegte Stunden. Ich bin von Jenny so erfüllt, wie seit langem von keiner Frau mehr. Es ist eine andre Liebe als etwa die zu Ella Barth. Ich bin viel mehr von innen her ergriffen. Ich möchte mich bei dieser Frau ausweinen – das ist es. Bei allen andern stehen sehr andre Wünsche im Vordergrund. Heut kam sie ins Café, total „molsch“, wie sie sich ausdrückte. Sie hatte gestern für ihren 15jährigen Bruder, den sie wohl sehr lieb hat, 100 Mk beschaffen sollen und es war nicht geglückt. Der Junge ist in Königsberg, hat da offenbar Schulden gemacht und hat nun Angst vor den Eltern. Jenny ist nun gestern wie besessen herumgelaufen, sogar zu Wucherern und hatte schließlich am späten Abend von 10 – ½ 3 Uhr im Stefanie gesessen und auf mich gewartet. Nun hatte sie wenig geschlafen und kam heut mittag. Ich freute mich über die Unbefangenheit, mit der sie im öffentlichen Lokal meine Hand nahm und streichelte. Und dann kam sie mit zum Mittagessen. Ich sagte ihr viel Liebes, und wie sie heute meine Hände und Haare streichelte, wie sie ihr Köpfchen mir an die Schulter legte, und sich die Stirn und die Haare küssen ließ, das zeigt mir deutlich, was die Glocke geschlagen hat. Zwar durfte ich ihren Mund nicht küssen, zwar war immer ein Abwehren in ihren Gesten und Blicken, aber darunter spürte ich zu gut die tiefe Zärtlichkeit und Zugetanheit. Sie muß auch wohl deutlich empfunden haben, wie stark und echt ich sie liebe. Mir wurden die Augen einmal so heiß, daß ich sie an ihrer Brust verbergen mußte. Da küßte sie mir lange und sanft die Stirn. – Ich begleitete sie dann. Auf der Straße gingen wir Hand in Hand. Ich sagte zu ihr: „Ich möchte Sie immer bei mir haben.“ Da erwiderte sie zuckend: „Bitte sagen Sie das nie wieder.“ – Was bedeutet das? Tat ich ihr weh? Hat sie Angst vor mir? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich jetzt ganz gewiß: Ich liebe Jenny und was ich jetzt an mir arbeiten will, das soll alles für sie geschehn. Ich glaube, mein Leben hat wieder ein Ziel. Ich habe wieder Hoffnung, glücklich zu werden.
Referat: Ich sprach gestern nachmittag mit Mariechen, die mich zu einem Spaziergang aufforderte. Unterwegs sagte ich ihr deutlich meine Meinung, ohne ihr natürlich irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ich sagte ihr, sie werde im Leben nicht von ihrem Mann loskommen, weil sie seine Prügel so nötig brauche wie seine Küsse. Vor allem riet ich ihr, fortan geschickter zu lügen, als sie es bei mir getan habe. Ich sei ein Mensch, den solches Verhalten kurze Zeit immerhin mal interessiere, bei andern werde sie bei dem konstanten Schwindeln schlechte Erfahrungen machen. Sie widersprach kaum. Ihr Interesse war von dem Wunsch absorbiert, irgendwoher 3 – 5 Mk zu bekommen. Auch erklärte sie, sie möchte nur reich sein: „Dann würde ich der Welt ins Angesicht scheißen.“ Sie fühlt sich wohl, wenn sie derartige Ausdrücke sagt. Aber mich stört der Ton. Erotisch hat die Frau – wohl durch Jennys Auftreten – jeglichen Reiz für mich verloren. – Abends hätte ich ins Residenztheater gehn wollen, wo Helene (Ilona) Ritscher als Hilde Wangel in Baumeister Solneß gastierte. Leider konnte ich Basil, dessen Billet ich erbitten wollte, telefonisch nicht erreichen, und ging erst vor Schluß hin, da mir Jacobi gesagt hatte, nachher werde die ganze Gesellschaft – mit Heinrich Mann etc – in der Odeonbar sein. Ich traf zuerst Fred, der jetzt mit der Ritscher zusammenlebt. Wir gingen vor den Bühnenausgang und erwarteten Steinrück und die Ritscher. Fred und die Ritscher, mit der ich mich sehr herzlich begrüßte, hatten in den Vier Jahreszeiten eine Verabredung. Steinrück war zu nervös, um mitzukommen. Wir gingen aber ein Stück zusammen und er war begeistert von der Leistung der Ritscher, die wahrscheinlich engagiert werden wird. In der Odeonbar traf ich das Ehepaar v. Jacobi, Heinrich Mann und Dr. Goldschmidt. Nach einer Weile rief Waldau an, wir möchten in die Kette kommen, ein Weinlokal in der I[c]kstattstrasse, wo ich vor Jahren mal eine Kneiperei mit der Gräfin zusammen mitmachte, die ein zur Lyrik übergetretener Staatsanwalt veranstaltete. Wir fuhren (ohne Goldschmidt) per Auto hin und trafen dort Gustel Waldau, Ludwig Thoma, Dr. Geheeb und eine Dame bei einer Erdbeerbowle. Es wurde dann bei viel Bowle sehr nett und ich kam zum ersten Mal dem Dr. Geheeb persönlich näher. Wir fuhren – ich war schon ziemlich angetrunken – in später Nacht per Auto zusammen heim, und er forderte mich auf, heute früh mit den Witzen zur Redaktion zu kommen. Dort war ich, traf dort Thoma und Dr. Beich[Blaich] (Ratatöskr-Owlglas) an und erhielt von Geheeb 30 Mk und vom Verlag ein neues Buch der Gräfin „Von Paul zu Pedro“. Ich ging nachher im Englischen Garten spazieren und las schon einige Kapitel. Es ist entzückend ... Im Munde spürte ich an der kranken Stelle seit kurzem das Entstehn eines Geschwürs und da ich nicht ohne Schmerzen war, ging ich heute nach Tisch zu Hauschildt. Der fand eine Haut, die so aussehe wie Diphtherie. Er nahm sie mit der Pinzette heraus. Ein großes dickes Membran, das scheußlich stank und wahrscheinlich auch den sauren Geruch des Nasenschleims bewirkt hatte. Ich bin froh, daß es heraus ist und spüle schon wieder mit Kamillen. Nach Hauschildts Meinung scheint es jetzt, als ob mir beim Zahnziehn der Oberkieferfortsatz gebrochen wäre. Vielleicht stammen diese Erscheinungen aber noch von jener Zahnextraktion vor 3 Jahren in Berlin, wo mir ein Zahnarzt ohne Narkose den letzten Backzahn herausriß und mir dabei den Backenknochen splitterte. Ich möchte aber jetzt wirklich endlich von der widerlichen Störung befreit sein. Kranksein ist denn doch noch ekelhafter als jede andre Schweinerei.
München, Sonnabend, d. 29. Juni 1912.
Ich sah Jenny gestern noch einmal. Während ich mit Nonnenbruch am Schachbrett saß, kam sie ins Café. Ihr Bruder hat noch einmal telegrafiert, und das geän[g]stete arme Mädel war wieder stundenlang herumgelaufen, um Geld für ihn aufzutreiben. Sie depeschierte ihm dann eine Vertröstung und versprach, als ich sie heimbegleitete, mich heute vormittag zu einem Spaziergange abzuholen. Jetzt ist’s ½ 12 Uhr und ich warte.
Nach dem Abendbrot kam gestern Frieda Gutwillig zu mir und erzählte unter vielen Küssen, daß sie ein Engagement in ein Gastspiel-Ensemble nach Lübeck angenommen habe. Ich werde ihr eine Empfehlung an Grethe mitgeben. – Ich forderte sie auf, da sie heute schon reisen will, sie solle nachts zu mir kommen. Sie war unschlüssig. Natürlich kam sie nicht. Sie läßt sich wohl ausziehn und überall anfassen, aber sie will doch „brav“ bleiben. Dieser Virginitätswahn ist schon etwas unglaublich Abgeschmacktes. – Übrigens bin ich ganz froh, daß sie nicht da war. Ich glaube, meine Unbefangenheit vor Jenny wäre wohl etwas herabgemindert worden. Und jetzt, wo ich so von Jenny benommen bin, täte ich einem andern jungen Mädchen gewiß unrecht, wenn ich sie etwas so Großes wie die erste Liebesnacht erleben ließe.
Im Gambrinus war zuerst garnichts los und es gab einfach eine Unterhaltung, die dadurch ganz nett war, daß ein Berliner Genosse da war. Nachher kam noch Sirch mit einigen Syndikalisten, darunter einem aus Genf, und schließlich füllte sich das Lokal so weit, daß ich gegen ½ 10 Uhr noch vor etwa 20 Personen einen Vortrag halten konnte. Ich schloß an den 200ten Geburtstag Rousseaus an und sprach etwa ¾ Stunden eindringlich und besser als in der letzten Zeit sonst. Schließlich Torggelstube, wo ich Herrn Singer, dem Ehemann von Rosa Valetti noch einen anarchistischen Vortrag hielt. Dr. Rosenthal war dort, Professor Schmutzler, die Schwester von Frau Roland, eine reizende rothaarige junge Person, mit einem Herrn, die Valetti, Muhr, Strauß, Charlé und Steinrück. Ich kam verhältnismäßig früh nach Hause und las das Buch der Reventlow zu Ende. Das moralfreieste Selbstbekenntnis, das ich je in der Hand hatte. Ein verblüffend ehrliches und menschlich anständiges Buch. Ich sehe die Gräfin vor mir.
München, Sonntag, d. 30. Juni 1912.
Gestern war der ganze Tag mit Warten auf Jenny ausgefüllt. Sie hatte vormittags kommen wollen, um mich zu einem Spaziergang in den Englischen Garten abzuholen, kam aber nicht. Ich saß nervös zuhause und wartete, wartete so nervös, daß ich nicht einmal arbeiten konnte, so drängend doch nachgrade die Aufgabe wäre, mit der neuen Kain-Nummer anzufangen. Ich ging dann ins Café Stefanie, in der Hoffnung, sie könne mich dort suchen. Sie kam nicht. Wieder heim – Mittagessen allein – Hofgarten: keine Jenny – Café Stefanie. Von dort schickte ich ihr gegen 4 Uhr einen roten Radler mit der Nachricht, daß ich bis 7 Uhr dort auf sie warten werde, dann ins Theater gehe und nachher in der Torggelstube Abendbrot essen und wieder warten werde. Um 6 Uhr kam sie ins Café. Ich war glücklich. Sie begleitete mich dann zum Residenztheater. Doch zog unterwegs ein Gewitter herauf, und schon in der Ludwigstrasse krochen wir in ein Auto, um nicht völlig zu durchnässen. Ich holte vom Hoftheater-Portier Steinrücks Billet und Jenny fuhr vom Residenztheater-Eingang mit dem Auto weiter, während der Gewitterregen klatschend einsetzte. Leider versäumten wir, für heute eine klare Verabredung zu treffen. Sie versprach nur, nachmittags zu mir zu kommen, sodaß mir nichts übrig bleiben wird, als auf den Hofgarten zu verzichten und nach Tisch zuhause zu bleiben. Wenigstens will ich dann mit der Kain-Arbeit beginnen. – Als Jenny fort war, stand ich noch lange in den Arkaden des Theaters und sah dem Wetter zu. Es war ein wunderschönes, sehr schweres und intensives Gewitter. Schlag auf Schlag Blitze und prasselnde Donnerschläge und die Straßen flimmerten vom peitschenden Regen. Im Theater gabs Shaws „Caesar und Cleopatra“ mit Helene Ritscher. Das ist eine prächtige Schauspielerin, und ich bin stolz darauf, vor etwa 6 Jahren schon als einer der allerersten auf sie aufmerksam gemacht zu haben. Sie wird wahrscheinlich anstelle der unmöglichen Michalek engagiert werden, obgleich die gesamte Presse ohne geringste Ahnung von Urteil die Ritscher ablehnt. Natürlich fehlts ihr noch sehr am Technischen, sogar die deutsche Sprache macht ihr, der Ungarin, noch Schwierigkeiten. Aber die Intensität, die Wärme, die Innerlichkeit, das Temperament, die Kraft und das herrliche Organ, – es gehört schier die ganze Borniertheit beruflicher Tageskritiker dazu, an dem allen vorbei blos die paar völlig gleichgültigen technischen kleinen Mängel zu sehn. Gelingt es den Kritikern, das Engagement der Ritscher zu hintertreiben, so lege ich im Kain fürchterlich los, besonders gegen „V.“, die Mauke-Vees in der „Münchner Post“, die über die Ritscher als Hilde Wangel urteilt, als ob ein Hund gegen die Wand gepißt hätte. Ich traf im Theater zu meiner Freude Liesel Steinrück, die verhältnismäßig gut aussah, aber nur noch ganz leise sprechen kann. Ich habe die schöne arme kranke Frau so sehr gern. Sie lud mich herzlich ein, sie mal in Tutzing zu besuchen. Ich will mal mit Jenny hinaus. – Ferner sprach ich Strich. Die Mutter des Pumas ist gestorben. Lotte wird nun also bald wieder hier sein. – Im Torggelhaus war kein Mensch. Ein paar minderwertige Leute des Künstlertheaters setzten sich zu mir an den Tisch. Ich ging aber bald, spielte im Stefanie noch Billard und kam zeitig heim.
Heut kam von Johannes ein sehr schöner lieber Brief. Ich war grade bei der Lektüre des „Godwi“. Es ist seltsam, wie ähnlich der Freund jenen Romantikern empfindet. Dieselbe Perspektive zur Welt, dieselbe Art der Freundschaft und Liebe, sogar derselbe Humor, der – meinem sehr unähnlich – nie mit Worten, sondern immer mit Metaphern und Symbolen spielt. Sein Baader-Buch wird in einigen Wochen fertig. Er will es mir widmen. Ich freue mich sehr darauf.
München, Montag, d. 1. Juli 1912
Gestern wartete ich wieder viele Stunden vergeblich auf Jenny. Erst um 6 Uhr wagte ich das Zimmer zu verlassen und suchte sie – wieder vergebens – im Hofgarten. Als ich um 7 Uhr ins Café kam, fand ich einen Brief vor, in dem sie sich entschuldigt. Der Brief war schon mittags abgegeben worden, und als ich ihn hatte, wich meine Nervosität und Trauer sogleich der ruhigsten Heiterkeit. Wie innig und gut ich das Mädchen liebe! Wüßte ich nur, ob ich hoffen darf. – Ich ging gestern abend noch ins Torggelhaus, wo ich eine große Gesellschaft antraf, von der schließlich die Herrn v. Jacobi und Muhr und die Damen Rosar nebst Frl. Fein und Mueller übrig blieben. Frl. Fein ist Schauspielerin und hat hier im Hoftheater als Clärchen und als Thekla gastiert, da sie als Ersatz für die unmögliche Neuhof in Betracht kommt. Ein feines, hübsches, interessantes Mädchen. Die Rosar erzählte Zoten. – Nachher kam zu aller Überraschung Wedekind, und es wurde nett, als nur noch er, Jacobi und ich übrig waren. Wedekind erzählte von seinem Berliner Erfolg. Dann sprachen wir über mich, und er versprach, mit Georg Müller zu sprechen, um ihn zum Verlag meiner Essays zu bestimmen. Ich zweifle stark, ob Müller es tun wird. Der steht auch auf der Liste der Leute, die nicht schön gegen mich gehandelt haben. – Wir gingen – Wedekind, Jacobi und ich – gegen 2 Uhr zusammen fort. Ich begleitete die Herren noch bis zur Ecke der Prinzregentenstrasse. Nachher traf ich im Stefanie Emmy mit den Herren Jentzsch und Ghutmann. Um 3 Uhr im strömenden Regen heim. – Heute sah ich nun Jenny wieder. Sie holte mich aus dem Stefanie ab. Schon im Café nahm sie gleich meine Hand und streichelte sie sehr lieb und sanft. Dann gingen wir zur Glückstrasse, wo sie im Vegetarischen Restaurant ihren Schirm stehn gelassen hatte und jetzt war sie bei mir, um sich das Buch der Reventlow auszuleihen. Ich möchte sie so rasend gern mal ganz gehörig abküssen. Aber ihren Mund gibt sie vorläufig nicht dazu her. Aber wenn sie mich mit ihren warmen braunen Augen anschaut und mir dabei ganz weich und zart mit der Hand durchs Haar fährt, bin ich wahrhaft glücklich. Ich habe sehr stark das Gefühl, daß wir beide zusammen gehören, und ich hoffe wirklich im Ernst, daß diese Freundschaft in naher Zeit zu engerem Bündnis führen wird.
Heut erhielt ich nun die Pensionsrechnung: etwa 148 Mk. Kommt hinzu 4 Mk fürs Mädchen = 152 Mk + 42 Mk für Johannes = 194 Mk. – Ich erhalte: 175 Mk von Onkel Leopold und Jenny besteht darauf, mir 8 Mk 50 für genossene Mahlzeiten zu ersetzen. 20 Mk besitze ich noch, von denen, bis das übrige Geld kommt, höchstens noch 10 dasein werden. Ich rechne heraus: 193 Mk 50, also 194 Mk. Das bedeutet, daß ich den Monat nach Zahlung der Rechnung mit 0,00 Mk beginne. Ob ich vom Simplizissimus viel zu erwarten habe? Ob mir Gotthelf etwas verschaffen wird? Ich weiß es nicht. Jedenfalls will ich auch den Versuch machen, Nonnenbruch anzupumpen. Ich sehe auch für diesen Monat wieder häßliche Nöte bevorstehn. Es ist wirklich entsetzlich, daß immer noch so garkeine Festigkeit, so garkein Halt in meinem äußeren Leben ist. Ich leide mehr als ich ertragen kann.
München, Dienstag, d. 2. Juli 1912.
Gestern nachmittag sollten die Herren Wenter und v. Maaßen zu mir kommen, um mit mir die Flasche Grand Marnier auszutrinken, die mir Wenter als Erfüllung jener Wette vom Gerner Krokodils-Fest geschickt hatte. Er telegrafierte aus Garmisch ab, da er den Zug versäumt habe. Maaßen kam, und wir unterhielten uns recht gut. Ich gab ihm die „Wüste“ mit, eines der letzten noch vorhandenen Exemplare, und er brachte mir später ins Café eine weitere von den Bibliophilen als Privatdruck herausgegebene Schrift: „Über den Lyrismus bei Max Halbe in seinen Beziehungen zur Anakreontik der Spätromantiker. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde an der Universität Omaha (Neb. U. S. A.). Eingereicht von Gussie McBill. Henheloe (N. C.) Print. D. Halfbeer. 1911.“ Eine niederträchtig boshafte aber äußerst amüsante Mystifikation, in der Max Halbe unglaublich verulkt wird. – Nachher gingen wir zusammen zum Krokodil, wo Streit, Kutscher, v. Jacobi, Wilm und Schmitz sich schon eingefunden hatten. Nachher kam noch Wedekind. Halbe saß in einer andern Ecke des Ratskellers mit Malyot, dem Komponisten Marschall (Gerhart Hauptmanns Schwager) und noch einigen Herren. Wedekind erzählte viel von Hellerau bei Dresden, wo er sich die Gartenstadt-Veranstaltungen des Jacques Dalcroze angesehn hat: Rhytmische Tanzübungen in Nacktkultur, sehr ähnlich seinen in Mine-Haha niedergelegten Erziehungstendenzen. Ich hätte große Lust, mal hinzufahren und mir die Sache anzusehn. Ferner berichtete Wedekind, daß er mit Müller schon über mich gesprochen habe und daß der geneigt sei, ein Buch von mir zu edieren. Ich werde nun also schnellstens zu ihm gehn. Später gingen wir in die Torggelstube, wo sich noch Halbe und Willy Lang zu uns fanden. An andern Tischen saß eine große Gesellschaft und pokerte. Frl. Fein war dabei und sah entzückend aus. – Halbe erzählte, daß ein Novellenband von ihm, der vor vielen Jahren bei Langen erschien, jetzt plötzlich für die Ullstein-Bibliothek angekauft sei, wofür er aus heiler Haut 8000 Mark erhalten habe. Er (Halbe) brachte mich und Maaßen im Auto heim.
Heut kam ein Brief des Rechtanwalts Geiss, der mich um 50 Mk mahnt, die ich ihm seit einer Verhaftung von Johannes vor Jahren schulde. Er will mich, wenn ich nicht binnen 3 Tagen zahle, verklagen. Dabei erklärte er mir damals, er werde mich nie um die Summe mahnen. Ich schreibe ihm. – Mit meinen Geldverhältnissen steht es so, daß ich dem Wirt wohl 20 Mk werde schuldig bleiben müssen. Vielleicht rückt Müller bald heraus. Morgen muß ich versuchen, den Simpl. mal wieder zu kränken. Es ist schon ein Elend. – Auf Jenny wartete ich heute wieder erfolglos im Café. Ich bin traurig, ihre Hand heute nicht in meiner gefühlt zu haben. Morgen will sie mich zu Tisch besuchen.
Ich muß zunächst mal den „Kain“ herrichten. Die Arbeit ist noch völlig zurück.
München, Mittwoch, d. 3. Juli 1912.
Gestern nachmittag wurde ich bei der Arbeit durch Herrn Hanns Fuchs gestört, der mir verlautete, ich müsse über das Zensurverbot seines mit Felix Dörmann verfaßten Stückes „Die heilige Sache“ im Kain eine Notiz bringen. Ich forderte ihn auf, mir einen Brief zur Veröffentlichung zu schreiben (der inzwischen eingetroffen ist) und schmiß ihn raus. Die Störung hatte mich aus dem Konzept gebracht, und ich ging ins Café. Dort wurde mir mitgeteilt, eine Lübecker ältere Dame habe mich in Begleitung eines jungen Herrn gesucht und lasse mir sagen, sie erwarte mich um 7 Uhr im Hofgarten. Jetzt lohnte es mir nicht mehr, wieder nach Hause zu gehn, und ich war von ½ 6 bis nach 7 Uhr im Hofgarten. Die Dame kam nicht. Ich habe keine Ahnung wer es war. Während ich dort spazierte, hoffte ich fortwährend, Jenny werde plötzlich auftauchen und das Gefühl, sie müsse kommen, war so stark, daß ich, als es enttäuscht war, recht mißgestimmt ins Café zurückkam. Dort traf ich Maxi. Ich lud sie einer momentanen Laune folgend zu mir zum Abendbrot und betrog somit Jenny zum ersten Male. Jedenfalls hatte ich deutlich das Gefühl, sie zu hintergehn, obwohl ich doch leider keineswegs so nahe zu ihr stehe, daß der Koitus mit einer andern Betrug gegen sie sein könnte, und ich tröstete mich damit, daß ich Maxi wirklich nur aus Liebe zu Jenny, eben weil sie meine Sehnsucht enttäuscht hatte und mir den ganzen Tag nicht begegnet war, ins Bett nahm. Es war übrigens sehr nett mit dem Mädel und ich fühlte mich nachher sehr guter Laune. Ich ging in die Torggelstube, wo ich mit Muhr allein saß, bis zu meinem Schrecken Fuchs erschien. Er quatschte viel und prätentiös und begleitete mich dann bis vor die Haustür. Unterwegs eröffnete er mir folgendes: Er habe einen Freund, namens Aloys ten Brink, der in Salzburg lebe. Der habe Geld, interessiere sich für mich und möchte gern sich mit einigen tausend Mark an einer wertvollen Sache beteiligen. Natürlich kam raus, beratende Stimme beim Kain. Das wies ich sofort zurück und setzte Fuchs auseinander: Wenn der Mann sich für mein Schaffen interessiere, so könne er sich nicht besser daran beteiligen, als indem er mich finanziere. Er solle mir ein Jahr lang einen Monatswechsel von 300 Mk (leihweise) geben. Dann könne ich arbeiten was ich wolle und ihm dankbar sein. Fuchs meinte, er werde den Herrn dazu leicht bewegen können. Eine schöne Hoffnung. Aber ich habe mir abgewöhnt, Hoffnungen als Realitäten zu werten, und Hanns Fuchs ist ein Schwafler.
Vorgestern hatte ich im Torggelhaus Gotthelf gesprochen und ihn gebeten, doch mal bei Rössler anzutippen, ob der nicht doch mal 100 Mk für mich herausrücken möchte. Gotthelf versprach es, und heute, als ich mittags vom Café mit Jenny zum Mittagessen kam, fand ich aus Starnberg ein Telegramm vor dieses Inhalts: „Einverständnis erwirkt. Erwarte Sie Donnerstag, 3 Uhr Torggelstube. Gruß – Gotthelf.“ – Ob ich diese Hoffnung als Realität nehmen darf? Nötig wärs. Denn ich könnte jetzt schon nicht mehr die Pensionsrechnung zahlen. – Jenny war reizend und lieb wie immer. Meine Gefühle zu ihr werden täglich inniger. Die hat mir der Himmel selbst geschickt.
München, Freitag, d. 5. Juli 1912.
Aus Lübeck ist die Mitteilung gekommen, daß Charlotte meinen fünften Neffen geboren hat. Papa, der sich, wie mir Grethe schrieb, in Mölln gut erholt hat, ist wieder dort. Ich muß nun Familienbriefe en masse schreiben, was mir grade jetzt, wo der „Kain“ meine ganze Arbeit fordert, sehr störend ist. – Gestern mittag war Jenny wieder bei mir. Wir waren zärtlicher miteinander als je. Sie küßte mir mehrmals weich und fest die Stirn, versagt mir aber zum Kuß immer noch den Mund. Ich glaube bestimmt, daß sie die Frau ist, die mir zu dauernder oder doch lange währender Gemeinsamkeit bestimmt ist. Ich sprach ihr ohne Rückhalt vom Heiraten. Sie ging auch darauf ein. Nur werden wohl mit der Familie Schwierigkeiten sein, die natürlich Rabbiner und all den übeln Kuppel-Klimbim verlangen wird, der die bürgerlichen Ehen so häßlich einleitet. Vielleicht würde ich mich auch dazu überwinden. Denn was ich damit erkaufen könnte, wäre großes Glück.
In der Torggelstube traf ich große Gesellschaft – darunter Gotthelf und Rössler beim Pokern. Ich mußte stundenlang untätig dabei sitzen. Endlich – nach 5 Uhr – sollte sich die Geldangelegenheit entscheiden. Gotthelf zog sich mit Rössler zurück und kam dann mit dem Bescheid wieder, Rössler hätte wieder zurückziehn wollen. Er habe sich die Sache anders überlegt. Ich hätte mich in einer Angelegenheit schäbig gegen ihn benommen und er wolle jetzt nicht die Wurzen sein. Auf Gotthelfs dringende Ermahnung habe er dann mit ihm folgendes ausgemacht: Gotthelf leihe mir aus eignem 50 Mark, während Rössler mich ermächtige, mir auf sein Konto bei seinem Schneider einen Anzug machen zu lassen. Die 50 Mk von Gotthelf nahm ich natürlich gern, zumal ein Vormittags-Besuch bei Geheeb erfolglos verlaufen war. Den Anzug will ich mir vorläufig nicht bestellen. Diese schiefe Stellung zu Rössler muß erst einmal grade gerichtet werden. Ich will ihm schreiben und ihn auffordern, die Aussprache, um die ich ihn schon einmal gebeten habe, endlich herbeizuführen. Ich bin mir einer wirklichen Unanständigkeit gegen ihn nicht bewußt. Daß ich dem Consul Anträge gemacht habe, war selbstverständlich. Er hatte mich selbst angestachelt, das Mädel zu „korrumpieren“ und der Consul war mir darin recht weit entgegengekommen. Daß Rössler sich plötzlich in sie verliebte und dadurch moralisch wurde, geht mich wenig an. Aber ich verstehe ihn psychologisch vollkommen. Er ist durch die Krankheit des Mädels sehr nervös. Außerdem ist dadurch eine sentimentale Note in seine Liebe zu ihr gekommen. Er will sie heiraten und es stört ihn jetzt, daß ich Zeuge einer Zeit war, wo seine Gefühle für sie noch weniger respektvoll waren. Diese störende Empfindung setzt sich bei ihm in einen Vorwurf gegen mich, in Antipathie und Ungerechtigkeit um. Ich will aber doch versuchen, die anständige Beziehung, die 10 Jahre lang zwischen uns beiden bestanden hat, und ausgerechnet in dem Moment aufhörte, wo Rössler Millionär wurde, wieder herzustellen. Vorher danke ich für seine Wohltätigkeit, so nötig ich den Anzug auch brauchte.
Abends war Sitzung des Neuen Vereins. Darüber morgen.
München, Sonnabend, d. 6. Juli 1912.
Zu jener Sitzung war ich nicht nur durch die offizielle Mitteilung an alle Mitglieder eingeladen, sondern noch speziell durch einen Brief des Vorsitzenden Dr. Rosenthal. Im Nebensaal des Künstlerhauses waren gegen 30 Personen versammelt und es wurde über die Wirksamkeit des Neuen Vereins beraten. Eine Debatte gab es zunächst, als der Direktor Fuchs vom Künstlertheater eine Art Fusion, mindestens aber ein Schutz- und Trutzbündnis zwischen dem Neuen Verein und dem Verein Volksfestspiele anregte. Ich hatte bei dieser Debatte den Eindruck, als ob alle aneinander vorbeiredeten und keiner, auch Herr Fuchs nicht, recht wußte, worum es sich handelte. Nachher sprach ich über Maßnahmen, die gegen die Übergriffe der Polizeizensur zu ergreifen seien, und die Diskussion darüber gestaltete sich sehr lebhaft. Ich schlug vor, in öffentlichen Versammlungen, die vom Neuen Verein zu berufen seien, gegen die ganze Institution der Zensur zu protestieren. Aber die Leisetreter behielten Recht. Man war allgemein nicht gegen die Einrichtung der Zensur überhaupt, sondern wollte ihr nur, wie in Preußen, ein Oberverwaltungsgericht überordnen, worüber vor einigen Tagen Müller-Meiningen im Landtag geredet habe. Es wurde – von Dr. Hagen, dem Redakteur des „Janus“ – empfohlen, Müller-Meiningen solle im Rahmen der Vereinsveranstaltungen einen Vortrag über die Zensur halten. Die Versammlung legte sich lächerlicherweise auf den Beschluß fest, daß unter keinen Umständen eine öffentliche Versammlung stattfinden dürfe, und schließlich wurde einstimmig ein Antrag von mir akzeptiert, nach dem der Vorstand ersucht wird, sich mit Müller-Meiningen wegen eines Vortrages über den Gegenstand in Verbindung zu setzen. Es war im ganzen eine wertvolle und angeregte Aussprache, und mir wurde später von vielen bestätigt, daß mein Auftreten dort und der kämpferische Ton, den ich in den völlig friedlichen Vereinskreis bringe, sehr wohltätig empfunden werde. – Ein starker Rest der Versammlung fand sich nachher in der Torggelstube zusammen, darunter Rosenthal, Wedekind, Schaumberg, Henckell etc. Zur Diskussion stand die Frage, warum sich die Intellektuellen von allem sozialen Leben fernhalten. Nachher wurde die Idee erörtert, ob nicht eine Umfrage veranstaltet werden sollte, anschließend an ein aktuelles Problem: Etwa die Frage, ob es dem Kulturbewußtsein der Menschen entspricht, daß die Kinder im Schulunterricht zwangsweise zu konfessionellen Bekenntnissen gedrillt werden. Die Umfrage sollte von ganz unkämpferischen, aber bedeutenden Leuten unterzeichnet werden. Als einer meinte, man solle sich die ganze Aktion erst mal im Bette überlegen, erwiderte ich, dann würde eine Frauenfrage daraus werden. Damit wurde die Unterhaltung abgebrochen. Ich fuhr mit Schaumberg, Rosenthal und Jadassohn heim.
Gestern arbeitete ich. Nach dem Abendbrot holte mich Jenny zur Gruppensitzung ab. Es waren nur wenige da, sodaß ich mir einen Vortrag ersparte. Dagegen beschlossen wir, für nächsten Donnerstag eine öffentliche Versammlung kleineren Stils im Gambrinus zu veranstalten. Ich soll über das Thema „Staat und Persönlichkeit“ sprechen. Ich ging mit Jenny fort: erst ins Café Plendl, dann spazieren. Wir kamen uns sehr nah. Als wir gegen ½ 2 Uhr im Schellingsalon landeten, sprach ich ihr ganz ernsthaft von meiner Idee, sie zu heiraten. Sie ging auch ganz sachlich darauf ein und wir amüsierten uns beide über die gänzlich unfeierliche Art, wie wir das Thema erörterten. Jenny reist (leider) am 20ten für 3 Monate nach Hause. Ich denke mir, daß sich in dieser Zeit wohl die Sache entscheiden wird. Sie wird in Eydtkuhnen merken, daß die ganze Geschichte mir keine Laune ist sondern überlegter Entschluß, der soweit geht, daß ich sogar die Peinlichkeiten einer Verlobung und kirchlichen Trauung auf mich nehmen würde. Wüßte ich nur erst, ob ihre Gefühle für mich so stark sind, daß sie an einer Verbindung mit mir recht täte. Sie schweigt sich beharrlich darüber aus, läßt sich Wangen und Stirn küssen und verweigert konsequent den Mund zum Kuß. – Heute wollte sie um 12 Uhr schon im Café sein. Ich wartete vergeblich bis ¾ 2. Sie wird wohl verschlafen haben.
München, Sonntag, d. 7. Juli 1912.
Mein Kopf ist voll Sorgen. Das Geld von Gotthelf ist bald wieder alle und wo soll Neues herkommen? Es ist alles so ganz aussichtslos. Vom Simplizissimus mußte ich die Karikaturen wieder nach Hause nehmen, weil meine Texte dazu nicht akzeptiert wurden und ich weiß schon garnicht mehr, wem ich noch Arbeit anbieten könnte. – Nun sprach ich gestern mit Steinebach über die Aussichten des „Kain“ und erfuhr, daß ich die Zahl der Abnehmer weit überschätzt habe. Es sind erst ganze 89 Abonnenten da und mit dem Einzelverkauf gehn nur etwa 400 Exemplare unter die Leute. Das ist wirklich verzweifelt wenig. Ich war ganz geknickt gestern abend, zumal ich auch den ganzen Tag Jenny nicht sah, die auch heute wieder nicht ins Café kam. Dabei geht es mir gesundheitlich immer noch nicht gut. Ich bin sehr verschleimt und spüre in Hals und Nase immer einen störenden säuerlichen Geruch, der mich entsetzlich verstimmt, da er mich immer fürchten läßt, ich müsse dadurch erotisch unmöglich sein. Wenn ich blos einen Arzt wüßte, der ein wenig mit solchen Dingen Bescheid weiß. Die Leute plagen einen nur, ohne zu helfen und ohne Ahnung, was für ein Phänomen sie vor sich haben. Exakte Wissenschaft!
In der Torggelstube traf ich abends Pepi. Muhr lud sie und mich zu Trefler ein, wo wir uns das alberne Programm bei Bissinger-Sekt anhörten. Pepi war sehr nett und streichelte mir oft lieb und freundlich die Hand. Ich ging dann – etwa um ½ 2 Uhr – zum Torggelhaus zurück, wo ich Gustel Waldau, Steiner und Max Halbe antraf. Wedekind saß besonders mit dem Feuerfresser Rudinoff und dessen Frau zusammen. Halbe brachte mich um 3 Uhr per Auto nach Hause.
Rowohlt schickt mir den lyrischen Nachlassband von Georg Heym „Umbra Vitae“. Ich habe ihn ersucht, mir auch das erste Gedichtbuch Heyms „der ewige Tag“ zu senden. Vom Verlage Weissbach in Heidelberg kam „der Kondor“, „eine rigorose Sammlung radikaler Strophen“ mit Beiträgen von Ernst Blass, Max Brod, Arthur Drey, S. Friedlaender, Herbert Grossberger, Ferdinand Hardekopf, Georg Heym, Kurt Hiller, Arthur Kronfeld, Else Lasker-Schüler, Ludwig Rubiner, René Schickele, Franz Werfel, Paul Zech, herausgegeben von Kurt Hiller. – Ich sollte schon vor Erscheinen für das Buch Reklame machen, was ich damals ablehnte, zum Teil, weil man mich nicht zur Mitarbeit aufgefordert hatte. Jetzt bin ich ganz froh, nicht darin vertreten zu sein. Das Buch ist miserabel, soweit ich nach flüchtiger Durchsicht taxieren kann.
Ich traf gestern in der Trambahn Franz Blei, der gleich von der Sammlung anfing. Auch er war empört. – Ich will in der Augustnummer des Kain ausführlich über Lyrik schreiben und das Buch dabei gründlich hernehmen. Neugierig bin ich auf den Versband des jungen Pragers Franz Werfel, den ich mir beim Verlag Axel Juncker in Stuttgart bestellt habe.
München, Montag, d. 8. Juli 1912.
Es ist schon Abend. Aber ich muß heute noch eine kurze Notiz der Freude und Beglücktheit hier herschreiben. Jenny hat mich heute geküßt. Geküßt ist kein Wort – ihr Mund lag an meinem mit einer Inbrunst, einer Wildheit und einem Heißhunger, daß ich jetzt weiß: von dieser Frau werde ich niemals im ganzen Leben mehr loskommen. Heute früh war eine Karte von ihr aus Herrsching gekommen, die mich etwas verstimmte. Irgend ein Student hatte mit unterschrieben und sich als „Gemahl z. Z.“ bezeichnet. Ich dachte nicht anders, als das sei die Mitteilung Jennys, sie habe ein Verhältnis angefangen und ich habe nicht mehr auf sie zu hoffen. – Aber heut mittag kam sie ins Café und erklärte die Bemerkung des Jünglings als harmlosen Ulk. Nachher kam sie zu mir Mittag essen. Sie erzählte mir viel von ihren Eydtkuhner Verwandten, und nach dem Essen setzte ich mich neben sie aufs Sofa, und wir hielten uns zärtlich umschlungen. Ich küßte ihr gelegentlich Augen und Wangen und sie streichelte mir das Haar. Nachher las ich ihr aus meinem Notizbuch Gedichte vor. Sie war anscheinend sehr davon ergriffen. Ich bat sie wiederholt, mich zu küssen. Sie tat es nicht, küßte mir aber mehrere Male die Hand, bis sie plötzlich und ganz spontan ihre Lippen auf meine warf. Ich hätte weinen mögen, so selig war ich. – Gleich darauf war sie wieder die alte, siezte mich und drängte zum Aufbruch. Wir gingen dann zusammen noch in den Hofgarten und zu Steinebach. Aber zwischen uns ist jetzt eine Verständigung, die nicht für den Tag ist. – Ich bin zu sehr erfüllt von dem guten Erlebnis, um all die kleinen Zwischenfälle von gestern und heute noch registrieren zu mögen. Dazu hats morgen noch Zeit.
München, Mittwoch, d. 10. Juli 1912.
Ich bin so verliebt, so erfüllt von dem herrlichen Mädchen, daß ich glaube, das meiste was in den letzten Tagen um mich herum geschah, weiß ich garnicht mehr. Ich will blos einige Daten kurz notieren. Sowohl vorgestern wie gestern war Zaza bei mir. Sie möchte gern von ihrem Béguin los und legte mir nahe, sie wieder unter meine Fittiche zu nehmen. Ich schenkte ihr reinen Wein ein: daß ich finanziell dazu keine Möglichkeit habe und nebenbei auch anderwärts verliebt sei. Jedenfalls will ich mich jetzt nach einem „Amant“ für sie umschauen. Ein liebes reizendes Mädel. Ihre sanften Zärtlichkeiten rührten mich, aber ich war im Geiste so sehr bei Jenny, daß ich zu keiner intimeren Herzlichkeit fähig gewesen wäre. Heute um 6 Uhr soll ich die beiden Frauen im Café miteinander bekannt machen. – Rößler hat mir geantwortet. Seine Verstimmung besteht noch, er mag sich auf prinzipielle Erörterungen einer Sache nicht einlassen, die die Intimitäten einer von ihm geliebten Frau betreffen. Er werde sich aber freuen, wenn ich mir bei seinem Schneider einen Anzug machen lasse. Ich will es tun. – Bei Georg Müller sprach ich mit Dr. Frisch. Man ist grundsätzlich bereit, Bücher von mir zu edieren. Ich soll die „Freivermählten“ und die vorhandenen Essays zu der „Scheinwerfer“-Sammlung vorlegen. Vielleicht kommt auch ein Gedichtband zustande. – Finanziell geht es mir wieder ganz übel. Mein Kapital beträgt 75 Pfennige, und ich weiß garnicht, wie es vermehrt werden kann. Bei der Zigarrenfrau habe ich auch schon wieder 2 Mk Schulden. Das macht mir arge Kopfschmerzen.
Zu Jenny: Sie kam gestern wieder ins Café. Obwohl sie schon gegessen hatte, begleitete sie mich heim, und nach Tisch empfing ich wieder ein paar sehr sehr süße heiße Küsse von ihr. Ich erreichte es dann auch, daß sie mir endlich Du sagt. Abends holte sie mich aus dem Stefanie zum Künstler-Theater ab. Wir fuhren im Auto hin, die Gesichter aneinander gepreßt, und ich fühlte, daß meine Liebe erwidert wird. Wir sahen „Orpheus in der Unterwelt“ von Offenbach. Es war schöner als im vorigen Jahr, wo der Riesenraum der Konzerthalle das intime Werk zerriß. Pallenberg war großartig, Halms Regieleistung aller Achtung wert. Wir fuhren im Auto zur Torggelstube und unterwegs gab Jenny mir mehrmals stürmisch die Lippen. Wir aßen in der Gesellschaft von Muhr, Weigert, der Valetti, der Schwab, Dr. Rosenthal, Strauß, Gotthelf und Keyserling Abendbrot und gingen um Mitternacht fort, Arm in Arm, Hand in Hand, ganz versunken in glückliches Zusammengehören. Ich führte sie durch menschenleere Straßen heim, sodaß wir uns schon auf der Straße einmal küssen konnten. Dann trennten wir uns unter vielen zärtlichen Umarmungen in ihrem Hausflur. – Es ist seltsam, wie schüchtern ich Jenny gegenüber bin. Ich hätte nicht gewagt, sie zu bitten, die Nacht bei mir zu bleiben. Vielleicht würde sie solcher Antrag sehr verletzen. Ich muß es schon meinem guten Glück überlassen, die Situation herbeizuführen, in der wir uns ganz finden wollen. Ausbleiben kann und darf sie nicht mehr. – Ich bin namenlos selig. Mein ganzes Leben scheint mir in neue gute Bahnen zu biegen. – Geliebte!
München, Freitag, d. 12. Juli 1912.
Jenny. Das hätte ich doch nicht für möglich gehalten, daß ich noch einmal so von innen her würde lieben können. Mein ganzes Dasein ist verändert, das Weltbild verschönt, ich selbst komme mir ansehnlicher und besser vor. – Ob sie mich liebt? ich weiß es nicht sicher, aber ich denke mir, sie könnte nicht so gut küssen, wenn nicht so etwas ähnliches wie in mir auch in ihr vorginge. Aber sie ist merkwürdig verschlossen in ihren Empfindungen. So ehrlich und frei sie von ihren Erlebnissen spricht, selbst von den intimsten – ich habe jetzt schon viel von ihrer – garnicht unbewegten – Vergangenheit erfahren, so ängstlich scheut sie sich, ihre Gefühle preiszugeben. Manchmal scheint es mir selbst, daß sie absichtlich mein Urteil über ihre Einstellung zu mir verwirrt. Was sie ausspricht, ist höchstens etwas, was meine Illusion dämpfen kann. So sagte sie gestern einmal, sie sei ein wenig neidisch auf mein starkes Gefühl. – Ob in den kleinen Chikanen, die ich von ihr erfahre, Absicht liegt? Ich hoffe nicht. Heut erwartete ich sie wieder vergebens im Café, und sie hatte fest versprochen zu kommen. Sie weiß genau, daß ich ungeheuer nervös bin, wenn ich sie erwarte, daß ich sterbenstraurig bin, wenn sie fortbleibt – aber sie telefoniert nicht einmal eine Entschuldigung. Ich bin sehr ratlos. – Gestern war ein schöner Tag. Ich war früh aufgestanden, obwohl ich erst um ½ 5 Uhr vom Bowleabend der Kegelbahn heimgekommen war, und gleich zur Druckerei, Korrekturen lesen. Da ein Defekt an der Setzmaschine entstanden war, war das Heft noch nicht fertig. Abends zur Versammlung sollte es aber vorliegen. So wurde abgemacht, daß ich mittags um 2 Uhr den umbrochenen Satz ins Haus geschickt bekäme. Der Bote sollte warten und dann sollte den ganzen Nachmittag dran gearbeitet werden, sodaß die ersten Exemplare am Abend völlig fertig wären. Ich ging ins Café und wartete auf Jenny, die kurz nach 1 Uhr kommen wollte. Ich wartete bis nach ½ 2. Sie kam nicht. Ich war maßlos nervös, ließ ihr Bescheid zurück und lief nach Hause, um den Boten der Druckerei nicht zu verfehlen. Natürlich hing ich den Kopf aufgeregt zum Fenster hinaus, immer in der Hoffnung, das geliebte Mädchen werde noch kommen. Sie kam wirklich – nach wenigen Minuten: nur auf einen Sprung, wie sie verkündete. Nicht einmal den Hut wollte sie abnehmen. Gegessen hatte sie schon und sah nach den zärtlichen Begrüßungsküssen zu, wie ich meine Mahlzeit verzehrte. Nachher kam der Kain-Umbruch von Steinebach und ich las die Revision, während sie neben mir saß und mich eng umschlungen hielt. Ich war unendlich selig, da ich merkte, wie sie durchaus nicht wieder von mir fortfinden konnte und wie jede neue Umarmung ihren festen Entschluß, unaufschiebbare wichtige Gänge zu besorgen, erschütterte. Bald saßen wir auf dem Sofa und erzählten uns gegenseitig von vielen Erlebnissen und die Zeit verging. Um 5 Uhr entschloß sie sich, den Hut abzunehmen. Um 6 Uhr endlich ging sie und ich begleitete sie bis vor ihre Tür. – Von unsern Gesprächen, die durch viele Küsse unterbrochen waren, ist dieses wohl das Wesentlichste: ich machte ihr in aller Form einen Heiratsantrag, den ich folgendermaßen begründete. Wir beide, sagte ich, entgehn uns doch nicht mehr. Führt unser Verkehr zu dem Wunsch, zusammenzuleben, – und bei mir sei dieser Wunsch schon jetzt durchaus vorhanden –, so ist der offizielle Eheschluß ein Präventiv gegen behördliche Schweinereien. Ferner sei uns beiden ein Wohnen in eigener Behausung lieber als in den ramponierten Möbeln einer fremden Wirtin, und durch eine Heirat werde die finanzielle Unterlage geschaffen. Drittens sei die Sache finanziell günstig. Ich glaube bestimmt, daß meine Familie sich, wenn ich heirate, und zwar ein Mädchen, aus gut jüdisch bürgerlichem Hause und mit Geld, nobeler als sonst zeigen werde, und daß mein Vater mir einen erhöhten Zuschuß bewilligen werde. Sonst aber sei ja durch die Zinsen ihrer Mitgift immerhin eine finanzielle Basis des Lebens geschaffen. Für Jenny habe eine Heirat den Vorteil, daß sie der elterlichen Obhut entrückt wird, dauernd von Eydtkuhnen fortkommt und mich als Ehemann ja in keiner Weise als Tyrannen zu fürchten habe. Solange wir uns lieben, ergebe sich ja in unserem Zusammenleben alles von selbst. Lieben wir uns eines Tages nicht mehr, so ergebe sich erst recht alles von selbst. – Ich sagte Jenny, daß sie die erste sei, der ich einen wirklichen ernsten Heiratsantrag mache, und sie erwiderte, daß das der erste vernünftige Heiratsantrag sei, den sie erhalte. Ihre Einwände waren diese: zunächst werde ich zur Erfüllung von Formalitäten angehalten werden, die mir sehr gegen das Gefühl gehn müßten (ich erklärte ihr, daß ich nach guter Überlegung entschlossen sei, das auf mich zu nehmen). Dann aber fürchte sie für sich allein aus dem Gefühl, verheiratet zu sein, eine Unfreiheit und Belastung. Schon daß sie ihren Namen wechseln müsse, verstimme sie und sie zweifle daran, ob sie die freiheitliche Kraft habe, alle diese Äußerlichkeiten, wie ich es wohl könne, ganz als Äußerlichkeiten zu nehmen. Wir einigten uns dahin: sie solle sich die Sache sehr durch den Kopf gehn lassen und mir von Eydtkuhnen aus schreiben, wie sie sich entschlossen habe. Fällt ihre Entscheidung bejahend aus, so fahre ich nach Berlin und versichere mich durch Vermittlung Onkel Leopolds der Zustimmung des Vaters (es soll, wenn wir schon die Konzession der Heirat machen, alles ganz konventionell und korrekt geschehn) und halte dann offiziell bei ihren Eltern um Jenny an. Die ganze Sache ist mir im Grunde so amüsant, daß ich zum Teil schon aus Neugier wünschte, sie käme zustande. Ich war noch nie in einer solchen Gespanntheit allen werdenden Ereignissen gegenüber. – Abends war nun also die Versammlung im Gambrinus. Leider nur gegen 40 Personen. Ich sprach über „Staat und Persönlichkeit“. Jenny saß neben mir. Zuerst war ich dadurch so befangen, daß ich eine Viertelstunde lang stotterte und den Faden nicht finden konnte. Als ich ihn dann aber hatte, sprach ich gut. Denn ich sprach fast nur zu Jenny und ich sah, wie sie unter meinen Worten zitterte. In der Diskussion sprach Sirch wunderschön und ungeheuer leidenschaftlich gegen den Staat und seine Organe. Im Schlußwort ging ich darauf ein und sprach sehr heftige Worte aus, die ich aber so formulierte, daß mit einer Anklage kaum zu rechnen sein wird. Nachher stellte Jenny mir ein paar Studenten vor, mit denen wir ins Café Plendl gingen. Einer war organisierter Sozialdemokrat, einer russischer Sozialist-Revolutionär, der dritte ein unpolitischer schlesischer Klugschnacker. Der Russe verstand wenig deutsch, die beiden andern redeten einen solchen stumpfen und gefühlsarmen Stiefel daher, daß ich bald mit Jenny aufbrach. Wir gingen das Thal hinunter zur Isar, und in den Isaranlagen fielen wir uns um den Hals und küßten uns. Es war ein langer schöner Spaziergang. Ich wagte nicht, sie um die Nacht zu bitten. Es ist seltsam, wie schüchtern ich bin. Alle meine Sehnsucht drängt danach. Am Nachmittag war ich mehrmals dicht daran, sie um alles zu bitten, aber jedesmal konnte ich vor Befangenheit nichts herausbringen. Als sie zuhause war, ging ich noch zur Torggelstube. Dort war alles dunkel. Ich fuhr im Auto zum Stefanie zurück. In der Amalienstrasse rief mich ein Mädchen an. Es war die kleine Hure Babette Abraham. Ich mußte sie enttäuschen, nahm sie aber mit ins Café und zahlte dort für sie. Dann spielte ich mit Herrn Dörr, einem höflichen Siebenbürger, Billard. Währenddem erschien zu meiner Überraschung Rudolf Johannes Schmied, so besoffen und so verwahrlost in seinem Gebaren, so zerrissen und aufgelöst in Krankheit und Irrsinn, daß ich bei der Nervosität nach der langen Rede und den schönen Stunden mit Jenny mich nicht zu ihm setzen konnte. Nach drei ging ich heim, in Gesellschaft von Emmy und Jentzsch, dem neuesten Paar. Emmy, angetan wie eine mittelalterliche Gauklerin, mit einem formlosen Kleid, um das ein riesiger brandroter Shawl hing. Sie klapperte mit den losen Schuhsoolen auf den Asphalt, und ärgerte damit die Schutzleute und b [Eintrag endet hier]
München, Sonnabend, d. 13. Juli 1912.
Um ½ 7 will Jenny zu mir kommen, und ich verliebter Esel komme
jetzt, 5 Minuten vor ½ 6 heiß und aufgeregt nach Hause, um sie nur ja nicht zu
verfehlen. Zur Tagebucheintragung wird meine Ruhe wohl noch reichen – und nun
will ich zwar nicht fortfahren, Jenny – kommt mir der Name denn immer in die Finger?! Emmys Aufzug beim Nachhauseweg in der vorigen Nacht zu schildern, auch ihren freundlichen Abschiedskuß vor meiner Haustür übergehn, obgleich er der letzte Kuß war, den ich empfangen habe, sondern ich will berichten, wieso ich die Einzeichnung hier so plötzlich abbrach. Ich war furchtbar deprimiert, weil Jenny nicht ins Café gekommen war, und schrieb, was das Zeug halten wollte, um die elende Qual der Enttäuschung zu übertäuben. Dabei steckte ich oft und immer wieder den Kopf zum Fenster hinaus, weil ich fortgesetzt hoffte, vielleicht werde die Geliebte doch noch überraschend kommen. Und wenn dann zwei, drei Dienstmädchen oder Radfahrer die Ecke Amalienstrasse herumgekommen waren und Jenny nicht, setzte ich mich wieder vor das Heft und schrieb weiter. Da klopfte es. Ich glaubte, ich soll sterben und rief mit stockendem Atem „Herein!“ – Jenny war es nicht, aber ein netter kleiner Gymnasiast, mit blauer Schülermütze und einem gr[...]denen offenen klugen Gesicht – 14 Jahre alt, wie ich nachher erfuhr. „Sind Sie Herr Mühsam?“ fragte er ohne Verlegenheit. „Der bin ich“. – „Ich sollte blos nachsehn, ob Sie da sind. Balder Olden wartet unten.“ – „Oh, ich lasse bitten.“ Der Junge lief die Treppen hinunter, und kam mit Olden wieder herauf, der ihn mir als seinen Vetter Harald – Nachnamen weiß ich nicht – vorstellte. Ich vermutete Olden in Madrid, wo er bisher Korrespondent der Kölnischen Zeitung war und erfuhr jetzt, daß er das Blatt nun in Kopenhagen vertrete und nur einen Tag sich in München aufhalte. Ich war froh, in meiner Zerknirschtheit unterhalten zu werden, und so fand ich Olden diesmal ganz sympathisch. Allerlei gleichgiltige Gespräche. Unser Stück „Haifischtee“ soll, wie er berichtete, eventuell doch
aufgeführt werden. Das Hamburger Schauspielhaus interessiere sich dafür. Es
müsse aber gründlich umgearbeitet werden. Ich erklärte, ich werde an dieser
Umarbeitung nicht teilnehmen (denn der Schmarrn interessiert mich weiß Gott
garnicht). Ich überlasse ihm völlig, das nach seinem Geschmack zu machen, gab
ihm auch Generalvollmacht für Unterhandlungen und Abschlüsse mit Verlegern und
Bühnen und beanspruche dafür nur ⅓ des Gewinns. Olden war einverstanden, – nun werde ich also mit dem Dreckszeug nichts mehr zu tun haben und vielleicht eines Tages mit einer Geldsendung überrascht werden. Olden erzählte, daß er seit 1½ Jahren mit Frl. Urbach, der ehemaligen Caro-Sekretärin verheiratet sei, – und dann gingen wir zusammen zu Georg Müller, wo er geschäftlich zu tun hatte. Ich nahm die Scheinwerfer-Aufsätze und die „Freivermählten“ mit, die ich Frisch übergab. Er will schnellstens lesen. Olden sprach inzwischen mit Müller selbst und ich erwartete ihn dann dort auf dem Korridor und unterhielt mich inzwischen mit Harald. Der ist Amerikaner, war bis vor zwei Jahren in Mexiko und besucht seitdem in Oldenburg das Gymnasium. Er spricht geläufig deutsch, spanisch und englisch. Ein forscher, hübscher, unbefangener Kerl. Nachher lud mich Olden zu einer Autofahrt ein und wir fuhren um Schwabing herum durch den Englischen Garten zum Hofgarten, wo wir Kaffee tranken. Abends wollte Olden nach Berlin abfahren. Um 6 Uhr trennten wir uns, und ich ging, bestrebt, meine Jenny-Not mit aller Gewalt zurückzudämmen ins Stefanie, wo ich erst mit Nonnenbruch Schach spielte, bis Gotthelf kam und ich mich mit dem wieder vor ein Schachbrett setzte. Um 8 Uhr kam ich heim und aß Abendbrot. Dabei hatte ich die stille Hoffnung, Jenny werde mich vielleicht zur Gruppensitzung abholen. Ich schrieb ihr einen kurzen Brief, in dem ich sie nun bat, heute (Sonnabend) ins Café zu kommen oder doch wenigstens zu telefonieren. Als ich die Marke eben aufkleben wollte, fiel mir ein, daß ja doch eine schwache Möglichkeit sei, daß sie allein zum Gambrinus gekommen sei und ich fuhr, den geschlossenen Brief in der Tasche, dorthin. Mein erster Blick fiel auf ihren hohen Strohkiepenhut, aber ich bezwang meine Seligkeit und begrüßte erst alle andern – ich war bald herum – ehe ich mich an ihre Seite setzte. Nachdem ich unter allgemeiner Unterhaltung ein Glas Bier getrunken hatte, gingen wir fort, und nun merkte ich, als Jennys Hand auf der Straße lose in meiner lag, daß sie sehr verstimmt war. Sie rückte nicht mit der Sprache heraus, deutete aber an, daß sie sehr unerfreuliche Briefe erhalten habe und den ganzen Tag zuhause geweint habe. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Kerl, mit dem sie mal was gehabt hat – ihr großes Erlebnis, von dem sie mir einiges erzählt hat, der sich dann sehr häßlich gegen sie benommen hat. Ich suchte so gut es ging zu trösten. Aber das ist eine schwere Aufgabe, wenn man Indiskretion vermeiden will. Sie wollte gleich heim schlafen, weil ihr vom Weinen Kopf und Augen wehtaten. Meine zärtlichen Worte freuten sie sichtlich, konnten sie aber nicht aufheitern. Vor ihrer Tür verweigerte sie mir den erbetenen Kuß, sehr lieb aber sehr bestimmt. Sie könne nicht. Ich fragte, ob sie heut können werde. Da lächelte sie und sagte: „Vielleicht“ – und dann mit lachenden Augen: „Ich glaube wohl.“ Sie versprach bestimmtest, heute zwar nicht ins Café aber um ½ 7 Uhr zu mir zu kommen (jetzt ist’s allmählich 5 Minuten nach 6 geworden, und ich laufe schon von Zeit zu Zeit ans Fenster. Oje, eben schlägts erst 6 Uhr. Meine Uhr geht vor). Dann trennten wir uns, nachdem ich ihr viele Male durch den Schlitz ihres Handschuhs hindurch die Handfläche geküßt hatte. Zwar stimmte mich ihre Traurigkeit etwas melancholisch, aber ich war doch beglückt, sie gesehn, gesprochen, gefühlt zu haben und ging in viel heiterer Laune, als ich den ganzen Tag gewesen war, zur Torggelstube. Erst saß ich dort bei Strich, Schnell, Alva, der Kündinger und Gottowt, dann ließ mich Fleischer, der Bariton aus der Berliner Schickele-Zeit bitten. Er ist ein Freund von Karl Borromäus Heinrich, der tuberkulös ist und in einem Sanatorium war (das erzählte mir neulich schon Gulbransson). Seine Frau war mit dem 1½jährigen Kind am Tegernsee, und da ist der Kleine ertrunken. Fleischer ist nun von Timmendorf, wo er mit seiner Familie die Ferien verbringt, (er ist Mitglied der Hofoper in Hannover) sofort zu seinem Freunde gefahren, ohne Geld zur Rückreise, das er von mir pumpen wollte. – Lange Gespräche über den neuen Theaterdirektor Adolf Lantz, der noch vor 2, 3 Jahren im Café Monopol herumlief und jeden Bekannten um 1 Mark anpumpte und jetzt mit Tausenden um sich wirft. – Als Fleischer gegangen war, setzte ich mich in den andern Raum, wo an einem Tisch Wedekind, Kutscher und einige Damen saßen, die von einer Wedekindvorlesung bei den Kutscherstudenten kamen, an einem andern Gustel Waldau und – sanft schlafend – Ludwig Thoma. Zu denen setzte ich mich.
Thoma wachte manchmal vorübergehend auf und sagte schlaftrunken sehr komische
Sachen. Dann ging er und forderte mich sehr freundlich auf, ihn mal wieder in
Rottach zu besuchen. Ich blieb dann in sehr guten freundschaftlichen Gesprächen
mit Waldau allein, der mich per Auto heimbrachte. Ein lieber feiner Mensch. Wir
kamen uns gestern zum ersten Male ganz menschlich nahe.
Ein Brief von Landauer ist gekommen. Er geht wieder nach Krumbach und will inzwischen meine Mitarbeit am Sozialist. Im August will er hiersein. Er beschwert sich über Nohl, der ihm offenbar die Zurückweisung eines Beitrags übelnehme. Ferner ein Brief von Johannes, der sich sehr beschwert, daß ich ihm seit Wochen erbetene Bücher aus der Staatsbibliothek nicht besorge, und der dringend um Geld bittet. Ich schrieb ihm gleich, daß ich leider nichts schicken kann, daß ich das Depot bei der Staatsbibliothek wieder abgehoben habe und was Landauer mir geschrieben hat. Außerdem eine lange Beichte meiner Gefühle für Jenny. – Jetzt fehlt noch eine Viertelstunde. Ich will durchlesen, was ich hier geschrieben habe und dann läßt sie mich hoffentlich nicht mehr lange warten. Auf daß der Tag sich fröhlich ende!
München, Sonntag, d. 14. Juli 1912.
Ich bin in grenzenloser Verwirrung. Alles ist durcheinandergeworfen. Das Neue, das mit Jenny in mein Erleben gekommen ist, hat mich um alle Sicherheit und Klarheit gebracht. Das ist ja vielleicht gut. Denn damit ist sicher erwiesen, daß ich noch weit entfernt bin von jener spießigen Gemütsordnung, auf der die überlegene Sicherheit der guten Bürger ruht. Aber diese Tage selbst sind furchtbar. Es ist eine Angst in mir, die an Verzweiflung grenzt, und jede Hoffnung, die mich erfüllt, ganz und gar ausfüllt, ist gemischt mit einer wahren Todesangst, daß sie zur Enttäuschung werden könnte. Ich liebe. Ich liebe so erschüttert und so durchdrungen wie kaum je. Ich will keinen Vergleich ziehen mit der Liebe, die ich für Frieda fühlte. Auch die war etwas ganz Großes, ganz Umgestaltendes. Aber die Empfindung ist jetzt – vielleicht nicht stärker, aber völlig anders, ganz neu für mich und durchdrungen von der Gewißheit einer Lebensentscheidung. – Ich glaube ja noch, daß alles gut wird. Aber so, wie die Dinge jetzt stehn, sind sie unerträglich. Gestern kam Jenny also zu mir, frisch, lebhaft und mit strahlenden Augen. Das erste aber war, daß sie mir ihren Mund versagte. Ich dachte ohnmächtig zu werden, umklammerte sie, bat. Sie wollte mich nicht küssen. Aber sie war lieb und gut, nahm meinen Kopf in ihre Arme, preßte mich an sich und legte ihre Lippen oft und gut auf meine Stirn. Eine Erklärung gab sie nicht. Vielleicht hat sie nebenher noch eine andre Beziehung, kam gerade von einem andern Mann und wollte, womöglich aus Schonung für mich, nicht den Mund hergeben, der noch von fremden Küssen feucht war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß ich namenlos unglücklich war und noch bin. Sofort mußte sie wieder fort, und bleibt heute ganz unsichtbar für mich. Erst morgen mittag will sie zu mir kommen, und sich ein paar Stunden für mich frei halten. „Es ist doch auch meinetwegen“ sagte sie, als ich sie bat, doch ein wenig gut zu mir zu sein. Was soll ich nur von alledem halten. Und zu denken, daß sie in ein paar Tagen abfährt, drei Monate fortbleibt und mich allein läßt in meiner Verzweiflung und Einsamkeit! Jenny! Jenny!
Ich begleitete sie dann mit der Elektrischen bis zur Theresienstrasse, wo ich abstieg, um ins Café zu gehn. Sie fuhr weiter, um angeblich Verwandte, die für kurze Zeit in München sind, zu treffen. Ich saß bis 8 Uhr am Schachtisch, aß ohne Appetit zuhause mein Abendbrot, ging ins Café zurück und spielte mit Bing Billard, dann traurig zur Torggelstube, wo kein Mensch war. Erst nach einer Weile kam Pepi. Sie sah reizend aus, und ich war gerührt, daß sie mir meine Bedrücktheit gleich anmerkte. Sie streichelte mir gütig die Backen und die Hände. Dann mußte ich ihr einen Brief an ihren Entreteneur, einen Baron v. Stetten diktieren, der verreist ist, und von dem sie Geld haben will. Sie ging, als Anthes mit Bruder und noch einem Herrn gekommen war. Ich zwang mich zu gesellschaftlicher Haltung und ärgerte mich über die unbedeutende Art der Herren, Gespräche zu führen. Mit den Brüdern Anthes noch ins Café Odeon. Dann im Stefanie eine weitere Partie Billard mit Tarrasch und heim. – Jenny hat mir gestern erklärt, daß sie mich im Stefanie nicht mehr aufsuchen werde, da ein Kellner dort einem ihr bekannten Studenten gegenüber über uns beide Klatschereien gemacht hat. Leider verbot sie mir, Krach zu machen. An sich ists mir nicht unangenehm, daß sie nun statt ins Café immer direkt zu mir heraufkommen will. Käme nur erst Klarheit in unsre ganze Beziehung!
Von Landauer eine Postkarte. Er will Auskunft über Panizza. Ich werde Scharf fragen. – Heinz Monnard ist gestorben. 39 Jahre alt. Ich war voriges Jahr mit ihm in Leipzig zusammen bei den Festspielen. Er hatte Kehlkopfkrebs und sein Tod kam niemandem überraschend. Aber es ist doch traurig um den flotten starken jungen begabten Menschen. Die Natur ist talentlos.
München, Montag, d. 15. Juli 1912.
¾ 12. Bis 12 Uhr hat Jenny Kolleg, dann will sie kommen. Ich will mich der aufregenden Erwartung nicht allzusehr überlassen und benutze die Zeit zur Tagebuchfüllung. Eine schreckliche Unruhe ist in mir, aber gestern kam ich ganz gut über den Tag weg, von dem ich Entsetzliches gefürchtet hatte. Gleich nach Tisch ging ich in den Hofgarten, wo ich Lotte antraf. Sie kam mir gleich entgegen, in Schwarz (da ihre Mutter gestorben ist), das ihr sehr gut steht, hielt mir die Hand zum Kuß unter den Mund und sagte leise: „Jane hat mich in Augsburg mit Kalser getroffen. Falls sie Dir was gesagt hat, nichts wissen!“ – Dann führte sie mich an den Tisch, wo Strich und Kalser friedlich beieinander saßen. Später kamen noch Fleischer und Benno Berneis an den Tisch und wir blieben lange dort sitzen. Ich verabredete mit Strich und Lotte, daß ich sie um ½ 7 Uhr zu einem Ausflug zur Florians-Mühle abholen werde und ging mit Fleischer und Berneis ins Ungerer-Bad schwimmen. Wedekind ging dort eben fort. Flüchtige Begrüßung. Das Bad war herrlich und tat mir außerordentlich wohl. Ich blieb lange im Wasser. Die verschiedenen Temperaturen der Quellen und Bassins sind etwas einziges in dieser Anstalt. Ich begleitete dann Berneis noch zu seinem Hotel und fuhr zu Strich hinunter. Verabredet waren nur Strich, Lotte, Kalser und ich. Doch kamen zufällig noch die Herrn v. Sörgel, v. Hörschelmann und van Hoddis. Hörschelmann, den wir gern bei uns gehabt hätten, konnte nicht mitkommen. Die beiden andern kamen unerwünschter Weise mit. Dieser Sörgel ist in seiner witzlosen Unbeträchtlichkeit und seiner aufdringlichen Arroganz recht widerlich. Das Puma ließ alle ihre Bosheit an ihm aus. Wir gingen die Landstrasse hinunter nach Freimann zu. Unterwegs sezessionierte ich mich eine Stunde lang mit dem Puma, das morgens erst von Berlin zurückgekommen war und wir bestätigten unsre alte Freundschaft und Kameradschaft, indem wir gegenseitig vor einander die Seele entlasteten. Sie erzählte mir von ihren neuen Betrügereien gegen den armen Strich. Die Einzelheiten, die uns sehr lachen machten, eignen sich nicht zu irgendwelcher schriftlichen Fixierung. Ich berichtete über die Entwicklung der Mariechen-Geschichte und beichtete die große Liebe, die mich plötzlich gefaßt hat. Lotte hörte aufmerksam und mit sichtlicher Sympathie zu. Ich war recht froh über sie. – Bei der Florians-Mühle aßen wir zu Abend, in der herrlichsten Luft unter grünen Bäumen. Erst um ½ 12 Uhr führte uns ein Automobil-Omnibus vom Großenwirt Alt-Freimann nach Schwabing zurück, und bis 1 Uhr saßen wir noch im Luitpold beisammen. Der lange Aufenthalt im Freien hatte mich tüchtig müde gemacht. Ich kam um ½ 2 Uhr heim und schlief bald fest ein, ohne noch lange von trüben Betrachtungen gepeinigt zu werden, die erst heute früh in aller Aufdringlichkeit wieder da waren.
Mit meiner Gesundheit bin ich garnicht zufrieden. Die Verschleimung, verbunden mit häßlichem säuerlichem Geruch, dauert an und macht mich allmählich ernsthaft besorgt. Außerdem macht sich plötzlich eine kahle Stelle auf dem Kopf bemerkbar, offenbar eine Allopecia areata, die ich schon zweimal gehabt habe. Ich will morgen zu Hauschildt, um
München, Dienstag, d. 16. Juli 1912.
Die Schreiberei gestern erfuhr die angenehmste Unterbrechung: durch Jenny, von der ich die zärtlichsten Küsse empfing. Sie war wieder ganz wie immer und blieb bis nach 3 Uhr bei mir. Ich wagte mich mit der Sprache heraus und bat sie um die letzte Gunst. Aber sie wollte nicht und gestand mir auf mein Drängen schließlich, daß sie mich zwar gern habe, aber doch nicht genug, um sich dazu entschließen zu können. Sie bat, nicht wieder davon zu sprechen. Nach ihren Ferien werde sie vielleicht selbst wollen und dann auch alles tun. Ich liebe diese Frau unsäglich. Jeder Gedanke gilt ihr, und es ist mir, als dürfte ich sie nie wieder von mir fortlassen. Ich begleitete sie dann zu Fuß zur Kanalstrasse, ging noch in den Hofgarten, wo ich mit den adligen Bibliophilen saß und dann ins Café. Schach mit Stieler und Schuster-Woldan. Abends Krokodil und Torggelstube. Dort kibitzte ich beim Pokern der Valetti und kam, von Anny Rosar und Charlé im Auto mitgenommen, erst um ½ 4 Uhr heim.
Heut mittag war Jenny wieder bei mir und ich darf mich auch heut nicht über mangelnde Zärtlichkeit beklagen. Das Gespräch ging wieder viel um den Heiratsplan. Ich suche ihr alle Bedenken zu zerstreuen und sagte ihr ausdrücklich, daß mein Antrag auch gelte, wenn sie sich zu einer geschlechtlichen Verbindung mit mir nicht verstehn könne. Daß ich sie liebe, sei eine Sache für sich. Die Heirat, die reine Formsache sei, wünsche ich im Interesse eines freieren Lebens, es würde eine eigentliche Geldheirat sein. Ich glaube fast, sie ist halb entschlossen, ja zu sagen. Als ich meinte, heiraten werde sie doch eines Tages, sie möchte sich über ihr eignes Wesen keiner Täuschung hingeben, gab sie zu, daß sie das auch glaube. Sie werde dann heiraten, wenn sie fühle, daß sie ohne ein Kind nicht leben könne. Wie schön und natürlich das Mädchen doch empfindet! Dürfte ich doch einst der Vater ihrer Kinder werden! – Ich begleitete sie in der Trambahn zur Landwehrstrasse, wo ihre Verwandten abgestiegen sind. Morgen nachmittag will sie wieder bei mir sein. – Ich ging zum Hofgarten. Wieder Maaßen und die Balten. Nachher Puma, das ich eben heimbegleitete. Sie erzählte mir köstliche Dinge von ihren Berliner Sünden. Unser Verhältnis ist doch sehr schön. Sie vertraut mir das Intimste und ich vertraue ihr mehr, als ich irgendwem andern sagen könnte. Ich hoffe, sie in diesen Tagen mit Jenny bekannt machen zu können.
München, Mittwoch, d. 17. Juli 1912.
Jenny will heut erst am Nachmittag um 4 Uhr kommen. So kann ich einmal Gedanken hervorlassen, die nicht unmittelbar mit ihr verbunden sind, und konstatieren, daß solche Gedanken nicht da sind. In alle Gefühle und Betrachtungen ist ihr liebes Gesicht, ihr liebes Wort, ihr lieber Kuß verwoben. Ist diese Leidenschaft wieder eine Enttäuschung, dann glaube ich, bin ich fertig. Dann gebe ich alle Hoffnung auf.
Dieser Monat verläuft sehr merkwürdig. Ich verdiene garnichts. Der Dalles ist permanent. Kürzlich teilte mir Diro Meier mit, daß die Abrechnung über die von mir garantierte letzte „Komet“-Nummer den Betrag von 1174 Mk ergeben hat. Da ich ihm 8 Mk schuldete, bat ich ihn, mir noch 18 Mk zu geben, und dann soll der Schuldschein über nunmehr 1200 Mk neu ausgestellt werden: immerhin 300 Mk weniger als zuerst vorgesehn war. Jenny gab mir schon – von ihrer Essensrechnung bei mir zweimal je eine Mark (heute soll ich den Rest von noch etwa 12 Mk kriegen). Gestern pumpte ich den Kellner Julius im Stefanie um 5 Mk an. Abends abonnierte Anthes auf den „Kain“ und zahlte mir den Betrag über 3 Mk 50 aus, und so ist für die allernächsten Tage mal wieder einigermaßen ausgesorgt. Dann muß ich sehen, endlich die Witze für den „Simplizissimus“ zu machen und am ersten hoffe ich durch den Müllerschen Verlag über die Zahlungssorgen hinwegzukommen. Aber es ist alles ganz vage, und wenn ich mir alles so besehe, kommt auch in diese Berechnungen immer wieder die Hoffnung auf eine Heirat mit Jenny hinein. Der Gedanke durch das Geld eines offiziellen Schwiegervaters und Eydtkuhner Bankiers aus meinen Sorgen zu kommen, hat garnichts Schreckliches für mich, da mir dabei nur die Erwägung maßgebend ist, daß ich durch die Hilfe des geliebtesten Weibes dahin käme, meinem Vater Gesundung und ein Leben zu wünschen, so lange wie er selbst es liebt. Wohin ich blicke – überall sehe ich von Jenny Heil kommen.
Gestern geschah nicht viel Bedeutsames. Ins Stefanie, wo ich allein saß, kam Annie Rosar, um mit mir zu sprechen. Sie hat zwei glänzende Engagement-Anträge: einen zu Rudolf Lothar nach Berlin, einen von Stolberg ans Münchener Schauspielhaus. Sie setzte mir das Einzelne auseinander und wollte meinen Rat. Ich riet ihr nach langer Überlegung, sie solle in München annehmen. Bei Lothar kann es eine Pleite geben und hier kann sie ein schlechtes Theater in die Höhe bringen. Sie ist noch unschlüssig. Abends Torggelstube. Steiner, Geyer (der Wiener), Anthes, Gottowt, die Rosar, die Valetti und kurze Zeit Gotthelf und sein Lottchen. Die beiden luden mich für einige Tage der nächsten Woche nach Starnberg ein. Das will ich gern annehmen. Es wird mir sicher gut tun. – Draußen im großen Raum saß Wedekind, kaute Bleistift und schrieb. Als ich vorbeikam, begrüßte er mich: „Ich gratuliere zur neuen Kain-Nummer. Ausgezeichnet – brillant geschrieben.“ Ich freute mich. Mit Steiner bis 3 Uhr Billard im Orlando. Dann allein zu Fuß dichtend heim. („Ich wende meinen Blick empor.“)
Frau Klara May, die Witwe Karl Mays schickt mir einen – schon abgesetzten – Aufsatz von Dr. Euchar Schmid „Karl May’s literarischer Nachlaß“. Sie bittet, ihn im „Kain“ zu drucken und ihr 50 Hefte unter Nachnahme zu senden. Lieber nicht. – Von Landauer eine Karte, zugleich mit dem ersten Juliheft des „Sozialist“. Er will für die nächsten Hefte Arbeiten von mir, da er sehr erholungsbedürftig ist. Natürlich werde ich ihm helfen. Aber mir graut, wenn ich meinen Arbeitsplan überdenke. Auch für Grossmanns Jahrbuch der Freien Generation habe ich einen Beitrag zugesagt. – Meinem Vorschlag, gemeinsam eine Fußwanderung – etwa durch den Schwarzwald – zu machen, stimmt Landauer sehr zu. So komme ich doch vielleicht auch in diesem Jahre in die Natur hinaus. Meine Nerven hätten es verflucht nötig, und die Zeit, wo Jenny fern sein wird, muß irgendwie überstanden werden.
München, Freitag, d. 19. Juli 1912.
Morgen abend wahrscheinlich, vielleicht auch erst Dienstag, reist Jenny ab. Mir graut vor den Monaten, die bevorstehn. In der nächsten Woche werde ich wohl ein paar Tage zu Gotthelf nach Starnberg gehn und dort zugleich versuchen, mit Rössler wieder in ein netteres Verhältnis zu kommen. Im August will ich – falls die Finanzen es irgend erlauben – Landauer in Krumbach oder Karlsruhe abholen und mit ihm eine Fußtour in den Schwarzwald hinein machen. – Ferner will ich so gut es geht, arbeiten und Briefe an Jenny schreiben und von ihr empfangen. – Vorgestern kam sie nachmittags zu mir – mit einer Stunde Verspätung. – Ich begleitete sie später in die Göthestrasse und ging abends kegeln. – Gestern waren wir den ganzen Tag beisammen. Sie holte mich um ½ 11 Uhr vormittags ab und wir waren bis 1 Uhr im Englischen Garten, aßen dann bei mir Mittag und blieben bis 4 Uhr zuhause unter vielen guten Zärtlichkeiten, die dann auch dazu führten, daß sie sich unter einigem Sträuben und in vieler Verwirrung von mir die zarten schönen Brüste küssen ließ. Alles weitere verhinderte sie aber mit viel Energie. Wir gingen zusammen in den Hofgarten und dann begleitete ich sie zu vielen Besorgungen. Während eines heftigen Regens waren wir in der Staatsbibliothek, und dort verhandelten wir an einem Fenster des Treppenhauses noch einmal eingehend den Heiratsplan. Vorläufig will sie nichts davon wissen. Sie fürchtet für ihre Freiheit und läßt sich von ihrem Vorurteil gegen den Trauschein (das ja an sich etwas sehr Anständiges ist) auch durch meine Versicherung nicht abbringen, daß für mich alle Trauungsformalitäten wirklich nur Formalitäten sind, daß ich sie zwar sehr liebe und mir eine engste Gemeinschaft mit ihr inbrünstig ersehne, aber aus einer offiziellen Eheschließung keinerlei Rechte über sie anmaßen werde. Ja, wenn sie ein Kind wolle, so werde sie sich den Vater dafür ohne jede Beeinflussung von mir aussuchen sollen. – Sie erklärte, daß für sie der Heiratsplan nur dann in Frage käme, wenn die Eltern sie etwa hinderten, nach München zurückzukehren. – Ich ging abends mit ihr in die Max-Emanuel-Brauerei essen. Dann trennten wir uns. Ich war abends in der Torggelstube und kam um 2 Uhr heim. Jetzt sitze ich wieder da und warte auf sie und mein Herz ist in Unruhe und in liebender Angst.
Frau Klara May erstickt mich in Drucksachen. Heut kam ein langer Brief von ihr, der von rührender Liebe zu dem verstorbenen Mann zeugt. – Es ist merkwürdig: meine persönlichen Beziehungen zu sehr bedeutenden und berühmten Persönlichkeiten haben mich niemals eitel gemacht. Jetzt aber, wo es sich um einen Toten handelt, der mir in meinen Schuljahren wie ein ganz Großer, wie ein gewaltiger Klassiker vorkam, und ich sehe mich plötzlich als den Vertrauten seines Weibes, das menschlichen Anteil für ihn erbittet, da ist mir ganz eigen zu Mute und ich komme mir vor, als wäre ich aus der Zeit genommen und Vertrauter und Tröster aller Verkannten und aller Generationen geworden. – Minna schickt mir endlich das im November in Berlin aufgenommene Familienbild – es ist ausgezeichnet – und die Hemden, die ich schon zum Geburtstag haben sollte und die mir jetzt sehr gelegen kommen. – Bald ist es ein Uhr. Jetzt will ich Jenny erwarten.
München, Sonntag, d. 21. Juli 1912.
Es ist eine Zeit höchstgesteigerten seelischen Erlebens. In Jenny erfüllt sich mir alles, was ich je in einer Frau suchen konnte: sie ist schön, klug, gut, zärtlich und vom gleichen Idealismus bewegt, der mir Halt gibt. Wollte ich sie heiraten, so brauche ich keine häßlichen Eingriffe der Familie zu fürchten: sie ist Jüdin, hat Geld und ist gesellschaftsfähig im Sinne der Bürger, die ja nichts von ihrem Leben und von ihren Erfahrungen wissen. Sie ist für mich Trost, Errettung, Glück und Erfüllung – und es fehlt nur noch eine Kleinigkeit, um durch sie ganz beseligt zu sein: sie zu erringen. Darum kämpfe ich nun, daran arbeite ich. Ich will sie heiraten, ganz regulär und bürgerlich. Wenn wir diese Konzession an die beiderseitigen Mischbochen machen, erreichen wir erstens friedliche Beziehungen zu den Familien, dann Ungeschorenheit durch die Polizei und vor allem ein eignes Heim, nach dem wir beide uns namenlos sehnen. Heute besprachen wir das alles sehr ausführlich, und heute habe ich zum ersten Male das Gefühl, als ob ich schon fest mit ihr verlobt wäre. Zwar warnte sie mich sehr, nicht zu fest auf ihr Ja zu bauen, aber als ich sie fragte: „Wirst du mich heiraten“, sagte sie „Wahrscheinlich“ und küßte mich. Ihre Einwände werden immer geringer und bedeutungsloser, und sie sieht das ein und wehrt sich nur noch mehr prinzipiell gegen den zu raschen Entschluß. Ich hoffe inbrünstig, noch in diesem Jahre mit ihr vereint zu sein.
Vorgestern telefonierte sie ab. Ich sah sie den ganzen Tag nicht. Auch zur Gruppensitzung war sie nicht gekommen. Dort war es sehr nett. Eine Anzahl jüngerer Kunden waren aus der Herberge gekommen und ich sprach zu ihnen von unsrer Stellung zur Arbeitsscheu. Wirkliche Trägheit gebe es nicht, und daß sich viele und die charaktervollsten Menschen nicht in Lohn zur Arbeit verdingen wollen, sei eben ein Beweis der Unsinnigkeit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Ferner über unsre Stellung zu den Eigentums-„Verbrechen“. Nicht den Dieben gelte unsere Abscheu, sondern den Einrichtungen, die die Menschen zum Stehlen treibt. – Ein jüngerer sozialdemokratischer Arbeiter sprach gutbürgerliche Worte gegen die Arbeitsscheuen und für die Bestrafung des Diebstahls. Der Student Bejach, ein organisierter Sozialdemokrat, derselbe, mit dem mich in der vorigen Woche Jenny ins Café Plendl geführt hatte, versuchte ausführlicher mich zu widerlegen. Ich legte ihn auf zwei Aeußerungen fest, einmal daß er behauptet hatte, Elend und Armut werde es immer geben müssen, zweitens daß er erklärte, ohne Zwang und Druck gehe es nicht. Ich fragte ihn, warum er denn mit diesen Überzeugungen überhaupt etwas andres wolle als den Gegenwartsstaat. Seine Schwärmerei für die Bearbeitung und Bekehrung der Massen suchte ich durch einen Hinweis auf die chinesische Revolution zu widerlegen. Die republikanische Bewegung dort sei gewiß sehr schwach gewesen, aber die leitenden Persönlichkeiten des Aufruhrs taten im Moment der Aktion das Richtige. Jetzt sei China Republik, obwohl es nie eine Republikaner-Majorität gehabt habe, und alle seien zufrieden damit. Die Diskussion gestaltete sich lebhaft und interessant, und Herr Bejach gab mir und Morax, der mir gut assistierte, erstaunlich viel zu. – Nachher Torggelstube. Direktor Barnowsky war da, Geyer, Wedekind, Gotthelf, Gustel Waldau und die Damen Rosar, Valetti und die hübsche junge aber dumme Breda, „die sächsische Duse“, von der Rössler behauptete, sie sächsle nur noch auf der Bühne. Allerlei recht lockere Gespräche. Um 3 Uhr heim.
Gestern mittag war Jenny bei mir. Wir blieben bis zum Spätnachmittag zusammen. Sonst bot der Tag nichts Wichtiges. Doch: Jenny berichtete, daß sie noch eine Woche in München bleibe. Sie hat Schwierigkeiten wegen der 100 Mk, die sie ihrem Bruder geschickt hat. Der Geldmann muß erst Erkundigungen nach ihrer Kreditfähigkeit einholen. Morgen will sie mit mir zu dem Manne gehn. Das liebe Mädel hat ihm zugesetzt, daß er mir eine größere Summe leihen soll. Angeblich giebt er Personalkredit auch ohne absolute Sicherheiten. Heut haben wir gewettet. Sie behauptet, ich werde 2 – 3000 Mk kriegen. Ich bezweifelte es. Wer gewinnt, soll dem andern 100 Mk zahlen. Daß doch Jenny gewinne! Wie gern gebe ich ihr aus dem Überfluß!
Heut lag ich noch im Bett, als sie kam. Eigentlich wollten wir wieder zusammen spazieren gehn. Aber es regnet ununterbrochen in Strömen, ein Wetter, das es nur in München giebt. So saß sie zwei Stunden bei mir am Bett. Viele Küsse. Endlich hörte ich von ihr das Geständnis, sie könne mich blos deshalb nicht in jeder Weise beglücken, weil sie mich zu hoch achte, um an mir einer bloßen sexuellen Laune nachzugeben. Also ist diese Laune doch da. Als wir später bei Tisch saßen, sagte sie einmal, als ich ihr irgend etwas Liebes sagte, ganz spontan: „So habe ich dich sehr gern.“ Heut bin ich ein gutes Stück weitergekommen mit ihr. Wir sprachen alle Einzelheiten für den Fall einer Verlobung durch. Dabei stellte sie fest, daß wir uns erst in Eydtkuhnen verloben könnten, und als ich lachend meinte, dann würden wir ja unsre Brautnacht ganz gesittet am Hochzeitstage feiern, erklärte sie kategorisch: „Das geht unmöglich“ und meinte, sie werde dann mal zu mir nach Königsberg kommen. – Heut habe ich zum ersten Mal den von Rössler gestifteten eleganten Maßanzug an. Vielleicht seit 20 Jahren der erste für mich angefertigte Anzug. Vielleicht hebt das meine Stimmung auch. Ich komme mir verjüngt und stark vor, und sehe die Zukunft rosiger und herrlicher vor mir als je im Leben.
München, Montag, d. 22. Juli 1912.
Gestern nach Tisch hatte ich im Café Lotte mit Kalser und Gottowt getroffen, und wir waren zusammen ins Luitpold gegangen. Das Puma forderte mich auf, um 7 Uhr bei Strich zu sein. Dort fanden sich zugleich Kalser und Alva ein und wir gingen zusammen zu Farina Abendbrot essen, nachdem ich Strich in einem billigen Zweimänner-Poker 1 Mk 30 abgewonnen hatte. Wir verabredeten, da die Sonntage in München so unerträglich sind, jeden Sonntag abwechselnd bei einem der Bekannten zuzubringen, und nächsten Sonntag nachmittag werden sich alle bei mir einfinden. Wir gingen von Farina aus wieder ins Luitpold, wohin noch Gottowt und Else Kündinger und – zufällig – van Hoddis kamen und später ich ins Torggelhaus mit Gottowt: Geyer, Waldau, Valetti, Rosar, Charlé, Strauß. Die beiden letzteren zogen sich zu einer Écarté-Partie zurück, an der ich mich auf Charlés Seite mit 5 % beteiligte (Gewinn 3 Mk). Inzwischen – Gottowt, Waldau und ich waren allein noch am Tisch zurückgeblieben – erzählte mir Gustel Interessantes von seiner Leutnantszeit, in der er öfters zum Dienst des kranken Königs Otto nach Forstenried kommandiert war. Ich erfuhr da manches, was mir unbekannt war über den Zustand und das Benehmen des Paranoikers, der mit Vorliebe seine Exkremente frißt. – Um 3 Uhr fuhren Charlé, Gottowt und ich zusammen per Auto nach Hause, ich wieder mit soviel Geld versehen, daß die Katastrophe anscheinend wieder um einen Tag hinausgeschoben ist.
Jetzt erwarte ich Jenny. Sie wollte gegen ½ 1 Uhr kommen – soviel ist es gleich – bei mir Mittag essen und nachmittags wollen wir dann zusammen zu dem Wucherer gehn und den großen Pump in die Wege leiten. Ich habe sehr viel Hoffnung, denn mir dünkt, was von dem herrlichen Mädchen ausgeht, muß gut sein und gut enden.
Abends.
Ich habe mich heute mit Jenny verlobt. Sie liebt mich, und, wenn nicht Satan selbst Minen legt und meine Hoffnungen zerstört, dann werde ich bald glücklich und erlöst sein. So komisch mir die Vorstellung ist, daß ich Bräutigam sein soll, so sicher weiß ich, daß ich recht tue, den kleinen Peinlichkeiten nicht aus dem Wege zu gehn. Mir ist die Verlobung und Hochzeit nicht Ziel meines Weges, aber ich verschmähe die Formalitäten nicht, da sie mir Mittel scheinen zu herrlicher Gemeinschaft mit Jenny. Ihr wert sein – das ist nun meine Aufgabe.
München, Dienstag, d. 23. Juli 1912.
Was gestern und heute im Einzelnen geschah, das kann ich unmöglich pedantisch registrieren. Es ist auch in meinem Herzen zu gut eingegraben, um noch verloren gehn zu können, und wenn nun Jenny mir fortab helfen wird, die Dinge des Lebens im Gedächtnis anzuordnen, so werden die Küsse und Worte unsrer letzten Verständigung keines besonderen Erinnerungsblattes mehr bedürfen. – Alle die Gründe und Ausflüchte, die sie gestern noch zusammenscharrte, um sich dagegen zu wehren, zu meiner Logik Ja zu sagen, mag sie selbst sich notieren, wenn[?] anders sie sie schriftlich erhalten sehn will. Ich kämpfte mit allem Aufgebot von Argumenten, die sie sophistisch nannte, für den Heiratsplan, bis sie endlich erklärte: „Wir werden heiraten“. – Zwar gab es auch dann noch Vorbehalte bei ihr, aber doch wußte ich gestern schon, daß sie gewonnen war. Und als sie heute früh zu mir ins Schlafzimmer trat, kündigte sie gleich eine Überraschung an, die lautete: „Wir heiraten uns totsicher.“ – Dann waren wir im Englischen Garten und fühlten und wußten uns ganz als Brautpaar, so weit wir auch von jenen Phrasen von ewiger Treue und all den sonstigen Verlobungsvorstellungen, die im Heiraten den Gipfel des Lebens sehn, entfernt sind. Wir werden nicht „ineinander aufgehn“. Aber wir werden versuchen, uns gegenseitig vorwärtszuhelfen, solange es geht in Liebe von Mann und Frau, wenn das nicht mehr geht in guter menschlicher Freundschaft. – Sie aß bei mir. Nach Tisch küßten wir uns unendlich viel. Und dann beichtete sie mir etwas, was sie für sehr schrecklich hielt: ihre Beine seien garnicht schön. Ihr war das Geständnis furchtbar schwer, aber ich hatte sie schrecklich lieb deswegen. Dann rückte sie auch mit dem Grund heraus, weshalb sie sich noch immer nicht zu völliger Gemeinschaft mit mir entschließen könne: sie habe hier in München allerlei erlebt, gleichgiltige Dinge, die sie „Sommersemester“ nenne, und die müßten erst durch die Abreise nach Eydtkuhnen ganz abgeschlossen sein. Nun ich wußte, daß nichts Ernsteres im Wege steht, wußten meine Nerven auch, was weiter folgen mußte. – Heute habe ich mit Jenny den Ehebund geschlossen: wir sind Mann und Frau geworden. Und jetzt wissen wir beide, daß unsre Ehe, solange sie immer dauern mag, für uns beide gut sein wird. Es ist eine schöne echte Liebe zwischen uns und ich bin endlich an jener Peripetie meines Schicksals angelangt, wo die sieben mageren Jahre zuende sind, und die sieben fetten Jahre beginnen.
Vorerst bin ich mit dem Jennyschen Geldmann (Hollweck u. Co) in Unterhandlung. Er will mir eventuell 5000 Mk zu günstigen Bedingungen verschaffen. 20 Mk sollte ich anzahlen. Ich pumpte mir von Jaffé 30, sodaß ich wieder einen Tag weiterkomme mit dem Geld. Jenny war mit mir beim Wucherer und später noch im Café Benz (gestern natürlich; die Erregung, in der ich bin, verwirrt meine Zeitbestimmungen einigermaßen). Wir saßen in einer Nische, und gingen manchmal ins Telefonkabinet, um an Jaffé zu telefonieren. Dort küßten wir uns weidlich. – Die Empfindung, geliebt zu werden, ist doch seliger als aller literarischer Ruhm. Heut las ich Jenny „Glaube, Liebe, Hoffnung“ vor. Sie ist ein dankbares Publikum. Ich glaube, mit ihr ehelich vereinigt, werde ich gute Sachen dichten. Ich bin wahrhaft glücklich und vertrauend.
München, Sonnabend, d. 27. Juli 1912.
Wedekind sagte mir einmal, das Tagebuchführen gewöhne man sich in dem Moment ab, wo ein starkes Erlebnis eintritt. Es scheint fast, als ob er recht behalten soll. Allerdings habe ich in den Tagen, die hier unausgefüllt blieben, kaum Zeit und Gelegenheit gehabt, Notizen zu machen. Ich mußte soviel küssen, daß zu allem andern weder Zeit noch Stimmung übrig blieb. – Mit Jenny bin ich nun also völlig einig, und wenn nicht alle Zeichen trügen, werden wir schon im Herbst als Ehepaar in München einziehn. Eingeweiht ist bis jetzt nur Onkel Leopold, dem ich unter der strikten Forderung absoluter Diskretion Namen und Daten angab, um, falls er es für nötig halte (Papa gegenüber) über Jennys Eltern Erkundigungen einzuziehn. Heut erhielt ich seine Antwort, aus der ich ersehe, daß von meiner Familie aus nicht nur keinerlei Schwierigkeiten zu erwarten sind, sondern mir jede Erleichterung gewährt werden wird. Ja, Onkel spricht selbst die Vermutung aus, daß Papa mir fortan den auf mich entfallenden Zinsertrag der Häuser auszahlen lassen wird. Das wären wohl sicher mindestens 6000 Mk im Jahr, und ich bin jetzt im Zweifel, ob ich die 5000 Mk die mir die Firma Masch und Co in Cöln evtl. auf Personalkredit besorgen will, überhaupt noch nehmen soll. – Daß ich jemals so durchaus Bräutigam sein könnte! Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Eydtkuhner Schwiegereltern. Aber die wird Jenny erzwingen. Sie liebt mich so wahr und inbrünstig, daß ich nicht den geringsten Zweifel habe, daß sie, selbst wenn sie auf harten Widerstand stoßen sollte, alles durchsetzen wird. Morgen früh reist sie ab. Im Laufe der nächsten Woche halte ich in aller Form brieflich um sie an, und stelle mich im September persönlich vor, reise mit Jenny nach Lübeck, um sie Papa vorzuführen und im Oktober heiraten wir. So ist bis jetzt das Programm. Getrübt werden unsere Flitterwochen, mit denen wir die Verlobungszeit ausfüllen möchten, leider dadurch, daß Jenny seit vorgestern ihr Unwohlsein hat. So mußten wir uns bis jetzt mit einem Piacere am Dienstag und zweien am Mittwoch begnügen. Eine Nacht hatten wir noch garnicht zusammen, so wild wir beide drauf brennen. Vorgestern abend – wir waren in einem Kientopp gewesen und fuhren unter zahllosen Küssen in einer Droschke heim, sagte sie plötzlich: „Ich bin ein Rhinozeros.“ – „Wieso?“ – „Ich hätte gestern nacht bei dir bleiben sollen.“ – – Wunderschön ist ihre Herbheit. Fast nie spricht sie eine Liebeserklärung aus. Höchstens mal ein sehnsüchtiges „Du!“ – Um so süßer ist es, wenn sie dann doch einmal sich entschließt. Vorgestern saßen wir auf dem Sofa, eng umarmt. Ich sah, wie sie den Mund auftat und im letzten Moment das Wort wieder herunterschluckte. Ich drang in sie, sie solle sagen, was sie aussprechen wollte, denn ich hatte ihr angemerkt, daß es was Liebes war. Sie sträubte sich sehr. Dann versteckte sie den Kopf an meiner Schulter und sagte ganz leise: „Ich bin so erfüllt von dir. Es ist fast zuviel Glück.“ – Und gestern sagte sie einmal mit einer Stimme, die mir die Tränen hochtrieb: „Du bist ein lieber Mensch.“ Nachher berichtete sie, daß es sie immer erst eine halbe Stunde Anstrengung koste, bis sie ein Liebeswort herausbringe. – Ich bin sehr neugierig auf ihre Briefe. Eins weiß ich: sie küßt fabelhaft und wird nie müde darin. Und noch eins: auf der ganzen Welt hätte ich keine Frau finden können, die geistig, seelisch, körperlich und praktisch so wie Jenny zu meinem Weibe geschaffen wäre. Ich bin absolut zuversichtlich. – Daß sie morgen abreist und wir uns etliche Wochen nicht sehn werden, ist freilich sehr schmerzlich. Aber insofern gut, als ich mordsmäßig arbeiten muß. Zuerst einen Artikel für den „Sozialist“ – er soll „Ehre“ heißen. Dann will Grossmann für das anarchistische Jahrbuch einen haben (über freie Liebe). Schließlich ist es hohe Zeit, den neuen „Kain“ zu schreiben. Bis jetzt weiß ich noch recht wenig von seinem Inhalt. – Ehe Jenny nicht fort ist, kann ich nichts tun als sie erwarten, wenn sie nicht da ist und küssen, wenn sie da ist. Heute packt sie, und die Küsse können erst nachmittags beginnen.
München, Dienstag, d. 30. Juli 1912.
Der Stein ist im Rollen. Neben mir liegen die fertigen Briefe an Vater und Schwiegervater. Morgen abend hoffe ich von beiden Seiten zu wissen, woran ich bin. Jenny sitzt im Zuge, unterwegs nach Eydtkuhnen. Bis heute hatte sich die Abreise verzögert, aber das war gut so, denn jetzt wissen wir beide, was wir von einander halten sollen und daß wir recht tun. In den letzten Tagen erst fanden wir uns ganz. Sonnabend nacht schlief sie bei mir. Sie mußte ihres Zustands wegen bekleidet bleiben, aber ihr Oberkörper lag nackt an meinem nackten Leibe, und obgleich nicht geschehn konnte, was unsre Fibern leidenschaftlich wollten, fanden und erfanden wir viele süße Zärtlichkeiten, uns unsrer Liebe zu versichern. Und die andern Tage waren wir fast immer zusammen und küßten uns und sagten uns Liebes und Verheißendes. Am schönsten war gestern abend eine Stunde auf meinem Zimmer, wo ihre Liebe plötzlich Worte fand, beglückende, heiße, hingebende Worte einer rührenden Leidenschaft. Heut früh habe ich sie nun in den Zug gesetzt und obwohl sie das „Schauturnen“ haßt, konnte ihr Mund garnicht von meinen Lippen finden. Es ist große Seligkeit, so geliebt zu werden. Nun habe ich den Werbungsbrief an Herrn Brünn in Eydtkuhnen geschrieben und an Papa die Bitte um seine Einwilligung. – Ich bin heut zu nervös, um hier mehr einschreiben zu können. – Wenn alles gut geht bin ich in 3 Monaten verheiratet. Schicksal, nimm deinen Lauf!
München, Mittwoch, d. 31. Juli 1912.
Meine Unruhe ist grenzenlos. Jetzt – 12 Uhr mittags – muß man sich in Eydtkuhnen und in Lübeck schon schlüssig sein, und von beiden Seiten hoffe ich heute noch telegrafische Nachricht zu bekommen. Jenny ist wohl schon zuhause und entweder sehr selig oder ganz unglücklich. Oder keins von beiden, falls sie noch kämpft. Das liebe prachtvolle Geschöpf! – Ich weiß eins: macht man uns unleidliche Schwierigkeiten, ich bin entschlossen, ganz rücksichtslos auf meinem Willen zu bestehen, und Jenny, wie ich sie kenne, wird mir helfen. Ich fürchte meinen Vater bei näherer Betrachtung doch eigentlich mehr als ihre Eltern. Vielleicht kommt plötzlich die Wut wieder in ihm auf, wie ich mich seit Jahr und Tag über seine Vaterautorität hinwegsetze. Vielleicht kommt die höhnische Antwort: Tu was du magst. Wenn du meinst eine Frau ernähren zu können, tu’s. Ich unterstütze dich nicht. – Aber ich hoffe doch eigentlich sehr, er wird vernünftig sein und die Erfüllung seines Lieblingswunsches, mich verheiratet zu sehn, nicht zum Anlaß nehmen, diesen Wunsch zu revidieren, was ihm allerdings zuzutrauen wäre. Es muß ihn doch auch rühren, daß ich die Mitteilung der Verlobung völlig in die Bitte um seine Zustimmung eingekleidet habe. Er kann ja nicht wissen, daß ich mich seinem Willen auch diesmal nur unterwerfe, wenn er mit meinem übereinstimmt. – Wenig begeistert wird er von der Mitteilung sein, daß wir keine proklamierte Verlobung und keine festliche Hochzeit wollen. Es soll doch immer alles nach dem Brauch gehn. Aber schließlich wird er sich doch damit zufrieden geben, daß überhaupt geheiratet wird und sogar außer dem Standesamt der jüdische Kultusapparat bemüht wird. – Heut wird er wohl mit den Schwestern und Schwägern sehr aufgeregt konferieren, und – wenn alles gut geht – schon seine Absichten in bezug auf seine materielle Hilfsbereitschaft kundtun. Wäre es doch so! – Ich möchte ihm so gern langes Leben und mir, auch natürlich, gute Beziehungen zu ihm wünschen. Was wir uns gegenseitig zu verzeihen haben, ist ja doch nur die Härte gegeneinander – und da habe ich mir weniger zu verzeihen als er sich. Denn was ich tat, geschah mit meiner Person zu meinem seelischen Nutzen; ich war hart gegen ihn, weil er, der andre Mensch, mich in meinen persönlichsten Entschlüssen behindern wollte. Meine Härte bestand in der Betonung meiner Selbständigkeit. Er aber war härter, denn er wollte seinen Willen in meinen Angelegenheiten über meinen setzen, und seine Härte war nicht Notwehr sondern Strafe und Pression. Vielleicht – Gott geb’s – gleicht sich jetzt endlich alles aus und wir finden uns in anständiger Weise wieder als Vater und Sohn zusammen. Um so heißer wünsche ich das, als ich es Jenny zu danken hätte.
Was soll ich außerdem groß von meinem Erleben berichten? Es erscheint mir alles was neben diesem Elementarereignis meiner Seele außerhalb meiner Seele geschieht, ganz nichtig und ganz wurscht. Nur um der Pedanterie willen, und weil mich es später mal interessieren könnte, einige Daten.
Sonntag abend, nachdem ich Jenny heimbegleitet hatte, ein ergiebiges Gespräch mit Wedekind in der Torggelstube. Über die Lyrik der „Rigorosen“ (ich will ihnen diese Bezeichnung, die ihr Herold Kurt Hiller in seiner Reklametuterei gebrauchte, zu dauernder Kennzeichnung anhängen). Über Kerr und seinen Kampf gegen § 175. Im Anschluß daran über den Berliner Intendanten Hülsen-Häseler, der homosexuell ist und Wedekind zu dem Epigramm veranlaßte:
Man hat es mich in Berlin gelehrt
daß Spinat zu den Hülsenfrüchten gehört.
Schließlich wieder über den „Kain“, den Wedekind sehr hoch schätzt.
Helene Ritscher schrieb mir aus England einen überschwenglichen Dankbrief für meinen Artikel „Kritinismus“ im Juli-Heft. Leider hat er nicht genützt. Wie mir gestern Gustel Waldau sagte, ist sie endgiltig nicht engagiert. Die Zunftkritiker haben es also mit ihrer Unfähigkeit wirklich zuwege gebracht, daß das Hoftheater dieses Riesentalent einfach weiterziehen läßt. Unerhört!
Etwas ganz Lästiges passierte mir gestern abend. Ich hatte den Dreimasken-Verlag angeklingelt wegen zweier Billette zur „Schönen Helena“. Sie wurden wegen angeblicher Überfüllung abgelehnt. Ich hätte mit Strich gehn sollen, während Kalser für sich und Lotte eingereicht hatte. Ich begleitete die beiden zur Ausstellung, und während Kalser sich noch um seine Karten bemühte, (die er übrigens nicht bekam) und ich mit dem Puma vor dem Theater stand, kam Sobotka und bat mich einen Moment zur Seite. Ich merkte, daß er wütend war, und jetzt rückte er auch gleich direkt heraus: „Wie kommen Sie dazu, überall herum zu erzählen, der Dreimasken-Verlag bezahle Meyrink für seine Kritiken?!“ – Ich gab ihm einfach zur Antwort, er möchte mich gefälligst mit dem Esel konfrontieren, der das behaupte. Er beschwichtigte sich dann auch, als er merkte, daß ich mir wirklich solcher Dummheit nicht bewußt war. – Ich habe allerdings, sehr gereizt durch die Behandlung, die mir bei meinen letzten Besuchen dort zuteil wurde, speziell durch die Arroganz des Herrn Jadassohn, verschiedenen Leuten wahrheitsgemäß erzählt, daß man mir dort nahegelegt hat, Reklameartikel für das Künstlertheater in den „Kain“ zu schreiben und durchblicken ließ, das man sich nobel zeigen werde. Aber jetzt möchte ich bei Gott wissen, welcher Schwätzer das so grotesk entstellt den Beteiligten wiedererzählt haben mag. – Die ganze Sache ist mir hauptsächlich Meyrink gegenüber peinlich. Ich werde, wenn ich nach Starnberg zu Gotthelf fahre, ihn zu sprechen suchen und die Sache aufklären, ehe sie ihm hinterbracht wird. Wie man Gerüchte macht! Die Konfrontierung soll stattfinden. Ich bin auf den Partner sehr gespannt.
Vorm Theater sah und sprach ich Pallenberg. Er schimpfte über den Betrieb dort und ging dann sichtlich sehr ungern hinein, den Menelaus zu spielen.
Heut früh war die Berufungsverhandlung wegen der Bahnhofsgeschichte. Zu meiner Verteidigung war Strauß’ Vertreter, Dr. Diers erschienen, der eben erst Anwalt geworden ist und die 3 Mk-Geschichte sehr wichtig nahm. Ich war noch der einzige, der die Berufung aufrecht hielt. Die andern waren stillschweigend ferngeblieben. Es wurde zwei Stunden um die Lappalien herumgeredet. Dr. Diers und ich bestritten die Rechtsgültigkeit der Verordnung, die den Aufenthalt im Bahnhofsrestaurant nur gestattet, wenn man außer dem Billet auch die Absicht hat, zu reisen. – Die Berufung wurde verworfen. Jetzt gehts an die höchste Instanz weiter: das Oberste Landesgericht. Ich komme mir schon fast wie ein neuer Kohlhaas vor, der für seine nächtliche Tasse schwarzen Kaffee kämpft.
Die Augustnummer des „Kain“ habe ich in Arbeit genommen. Ich will sie schnell vorwärtsbringen, um baldmöglichst für meine Reisepläne frei zu sein. Bewegte Tage.
München, Donnerstag, d. 1. August 1912.
Noch immer keine Klärung, keine Sicherheit, kein Aufatmen. Die beiden Telegramme sind eingelaufen. Aber es ist grade umgekehrt gekommen, wie ich gefürchtet hatte. Papa drahtet mir: „Bin mit großer Freude einverstanden. Meinen Brief abwarten“. Jenny depeschiert: „Sehr kühl allem gegenüber. Abwarten. Wird durchgesetzt. Jenny.“ Das arme süße Kind. Sie wird harte Stunden haben. Hoffentlich – ich glaubs fast – nützt mein Brief an die Eltern, der spätestens heut früh eingetroffen sein muß, – wenn ich ihn recht beurteile, war er ein Meisterstück diplomatischer Briefstellerei: ganz sachlich, ganz geschäftlich, aber mit einem leichten Unterton seelischer Ergriffenheit. Ich vertraue ganz auf Jennys starke gute Liebe zu mir, die sie die rechten Mittel finden lassen wird, den Widerstand der Eltern zu brechen. Spätestens morgen früh erwarte ich ihren orientierenden Brief, und dann wird wohl auch Papas Brief da sein. Was mag er enthalten? Ich fürchte, konventionelle Forderungen für die Eheschließung, ich hoffe, die Ankündigung seiner finanziellen Hilfe. Abwarten! Das Wort steht in beiden Telegrammen. Ich will versuchen, abzuwarten, ohne vor Nervosität zu explodieren.
Gestern abend versuchte ich, mir die Unruhe durch das Theater zu vertreiben, nachdem ich nachmittags 3 Stunden in den letzten Nächten versäumten Schlafs nachgeholt hatte. Es gab im Lustspielhaus zum vierundvierzigsten Male „die Zarin“, ein dreiaktiges Schauspiel von Melchior Lengyel und Ludwig Biro, das ich zum ersten Mal sah. Ein gutes Theaterstück, solange es nicht – im dritten Akt – ins Schwankhafte entgleist. Aber viel Schwächen und zuviel Effekt. Das Spiel war im allgemeinen schwächlich, aber ausgeglichen. Bemerkenswert war Ida Roland als Katharina II. Ihre stärkste Rolle, die sie fabelhaft spielt. Alle die Eigenschaften, die sie mir sonst so unsympathisch machen, kamen ihr glänzend zustatten: die Resolutheit mit dem Stich ins Ordinäre, die Routine im Verführen, Bestechen, Schönscheinen. Man muß ja, mag man die Frau als Schauspielerin auch hassen, unbedingt zugeben, daß sie Enormes kann. Diese Katharina spielt ihr keine einzige Kollegin nach.
Nachher Torggelstube: Schnell und Dr. Rosenthal. Mit Schnell im Orlando Billard. Die Allopezie, an der ich leide, ist noch garnicht besser geworden. Ich behandle die kahle Stelle mit Schwefelseife und Schwefelsalbe. Aber ich sehe noch gar keinen Erfolg. Wenn nur Hauschild zu verhindern weiß, daß die Glatze an Ausdehnung gewinnt. Das wäre ja entsetzlich, wenn ich Jenny das nächste Mal als Kahlkopf gegenüberstehen müßte.
Johannes schreibt mir einen verzweifelten Brief. Es geht ihm elend schlecht. Iza bekommt überhaupt kein Geld mehr, und er bittet mich, ihm das Geld am ersten pünktlich telegrafisch zu schicken. Leider kann ich das nicht, da mein Geld noch nicht angekommen ist. Ich habe Onkel L. gebeten, 2 – 300 Mk draufzulegen, und ich bin sehr gespannt, ob er das in Anbetracht der großen Wandlung tun wird. Wenn nicht, weiß ich überhaupt nicht weiter. Von meiner Verbindung mit Jenny – das beruhigt mich sehr – wird auch der Freund einen Nutzen haben. Jenny ist völlig mit mir einig, daß wir ihm reichlich schicken wollen.
München, Sonntag, d. 4. August 1912.
Mehr aus Pflichtgefühl als aus Bedürfnis setze ich mich vor diese Blätter. Geist und Seele sind so beschäftigt und von soviel heftigen Erlebnissen erregt, daß mir die Verdauungstätigkeit der Tatsachenaufzeichnung wirklich fast verfrüht erscheint. Mir ist, als könnte man das alles, was ich jetzt durchmache, nur als Erinnerung buchen, und die Gefahr, das Gedächtnis könnte getrübt sein, scheint mir während des Verlaufs der Begebenheiten größer als vielleicht nach ihrer Abklärung. – Jennys und meine Aussichten sehn sehr trübe aus, und ich sehe große Kämpfe, große Unzuträglichkeiten bevorstehn, bis alles geklärt ist. Von Jenny kam vorgestern ein Brief an, sehr verwirrt, sehr aufgeregt, unmittelbar nach ihrem Eintreffen in Eydtkuhnen geschrieben. Erfreulich in dem Schreiben ist nur das wundervolle Durchschimmern ihrer großen Liebe zu mir. Das Tatsächliche recht bitter. Ihre Eltern stehn der Sache offenbar ganz ablehnend gegenüber. Sie verhalten sich kalt und herzlos der Tochter gegenüber, die unter der Gleichgültigkeit des Vaters und dem „bornierten Entsetzen“ der Mutter furchtbar leidet. Sie kündigt an, daß sie vielleicht nach dem 10. August plötzlich an mich telegrafieren werde: „Komme!“, damit dann durch die Gewaltaktion meines persönlichen Eingreifens die Situation geklärt wird. – Fast gleichzeitig von Papa und von Grethe Briefe. Große Freude über meinen Entschluß. Grethe schreibt sehr lieb und wirklich ergreifend herzlich. „Du guter Mensch“, nennt sie mich, eine Vertraulichkeit, die unter uns Geschwistern nie üblich war und mich umsomehr freute. Papa schreibt, er sei nicht nur einverstanden, sondern „gradezu beglückt“. Das habe er in seinem Alter nicht mehr zu hoffen gewagt, daß ich ihm diese Freude machen werde. Dann aber leider der Pferdefuß. „Du wirst Deine neuen Verwandten darüber nicht im Zweifel lassen dürfen, daß Deine Existenz nur für Dich ausreicht. Werden Dir von Seite der Eltern des jungen Mädchens nicht ausreichend Existenzmittel zur Verfügung gestellt, so kann Deine Verheiratung natürlich erst in späterer Zeit erfolgen.“ – Der reiche Mann denkt also nicht daran, auf meinen Anteil an den Häusererträgen, auf die ich zu seinen Gunsten verzichtet habe, ohne die Konsequenzen übersehn zu können, zu verzichten, um mein Lebensglück dadurch zu ermöglichen. „Erst in späterer Zeit“ – das kann doch nur heißen: wenn ich tot bin. Also eine ganz klare Aufforderung: hoffe, daß ich möglichst bald sterbe, dann wirst Du glücklich sein dürfen. Unverständlich, absolut rätselhaft. Ich kann mich bei allem guten Willen in diesen Greisenkopf nicht hineindenken. Und nun heute von Jenny ein neuer zwölf Seiten langer Brief. Wie das Mädchen mich liebt! Das macht mich wahrhaft froh. Aber daß wir so leiden müssen, ehe wir zum Ziel kommen! Die Eltern wehren sich offenbar mit Händen und Füßen gegen die Verbindung. Warum? weiß ich noch nicht recht. „Primitiver Egoismus“ schreibt Jenny. Aber das erklärt mir nichts. Wieso entspricht es dem Egoismus der Leute, Jenny nicht mit mir verheiraten zu wollen? Ich habe ihr geantwortet und sie nach Näherem gefragt. Ferner habe ich ihr vorgeschlagen, die Verlobung einfach in die Zeitungen zu proklamieren, damit die Eltern überrumpelt werden. Ich sehe allem sehr besorgt und aufgeregt entgegen, nur mit dem Trost, daß unsre Liebe stark und zu jeder Wehr gewillt ist.
Donnerstag abend kam Landauer. Wir trafen uns um 11 Uhr im Luitpold. Ich hatte ihm in meiner Pension Unterkunft besorgt. Vorgestern waren wir – mit Berndl – den ganzen Tag zusammen. Gestern fuhr er zu Berndl nach Dachau hinaus. Inzwischen kam Siegfried Jacobsohn zu mir. Wir waren bis zum Nachmittage zusammen, wo ich wieder Landauer traf und in den Zug setzte. Ich werde Feuchtwanger für die Zeit seiner Abwesenheit bei der „Schaubühne“ vertreten, wahrscheinlich nur 3 – 4 Monate. Landauer weihte ich in die Verlobung ein. Er war sehr erfreut, hatte aber schon was geahnt. Es ist seltsam, wie schwer sich solche Dinge verheimlichen lassen. Heute sagte mir Walter Strich auf den Kopf zu, daß ich heiraten wolle, obwohl er glaubhaft versicherte, daß das Puma ihm nichts verraten habe. Aber es macht nichts. Auch Jenny schreibt, daß ich es ruhig publik machen soll. Das kann den Eltern gegenüber nur nützen, und mir ist jetzt alles einerlei: nur haben will ich sie, ganz und dauernd bei mir haben. – Onkel Leopold legte der Geldsendung 200 Mk bei, von denen Hans und er je 100 Mk gegeben haben. Leider bleibt mir nicht viel übrig – keine 100 Mk, wenn ich die Schulden vom Juli abzahlen soll. Es ist alles sehr wirr in mir und um mich. Aber trotz aller Schatten glaube und vertraue ich, daß wir kraft unsrer heiligen Liebe siegen werden.
München, Montag, d. 5 August 1912
Von Jenny heute keine Nachricht. Ich ängstige mich sehr um die Geliebte, die wahrscheinlich – und um meinetwillen – böse Tage bei ihren eigensüchtigen Eltern verbringt. Mir bleibt nichts übrig, als von Tag zu Tag auf gute Nachrichten zu hoffen. –
Heut früh wurde ich sehr erfreut durch eine Postkarte des Consuls aus Starnberg. Das gute Mädel lädt mich sehr freundlich ein, in diesen Tagen mal hinauszukommen. Rössler schrieb einen Gruß unter die Karte. Zugleich von Rössler ein Brief, in dem er mich bittet, ihm Mehrings Broschüre „Meine Rechtfertigung“ und Hardens Artikel „Trianon“ zu besorgen. Er braucht die Sachen wahrscheinlich als Material für das Lustspiel „die Hofgänger“, an dem er arbeitet. Jedenfalls scheint er mit mir Frieden schließen zu wollen, und das ist mir aus persönlichen und sachlichen Gründen recht lieb. Morgen sehe ich die beiden in der Stadt. Aufs Wiedersehn mit Consul freue ich mich ehrlich.
Die Tonsur auf meinem Kopf wird leider garnicht kleiner, und nun fängt auch die verdammte Zahnlücke wieder an sich zu entzünden und wehzutun. Ich will gleich zu Hauschild. Ich glaube, alle diese körperlichen Leiden sind ganz nervösen Ursprungs. Meine Erregung wegen der Jenny-Affaire macht sich in meinem ganzen Sein fühlbar. Aber wie gern ertrage ich alles, wüßte ich nur, daß es bald zu gutem Ende führt.
München, Mittwoch, d. 7. August 1912
Es regnet – regnet, wie es nur in München regnen kann: ununterbrochen in langen öden triefenden Wasserfladen. Und dies trübseligste aller Wetter entspricht ganz meiner augenblicklichen Gemütsverfassung. Von Jenny, die nun acht volle Tage fort ist, seit drei Tagen kein Wort, – und ich verzehre mich vor Verlangen nach ihrem Gruß, nach einer leisen Versicherung ihrer Liebe und ihrer Festigkeit, zu mir zu halten. Statt dessen kam gestern ein Brief von Papa. Ich hatte es für ratsam gehalten, ihn über den Stand der Dinge auf dem Laufenden zu halten und hatte angedeutet, daß sich bei den Schwiegereltern Schwierigkeiten herausstellen. Nun schreibt der alte Herr seine Meinung darüber, ohne Vorwürfe gegen mich, das ist wahr, aber von einer solchen senilen Philistrosität, daß mir schwach wird. Ich könne eine Frau nicht ernähren, verdiene noch nicht einmal genug, um selbst davon existieren zu können. Deshalb täten die Eltern Jennys ganz recht, wenn sie mir ihre Tochter nicht anvertrauen wollten. Trotzdem hoffe er auf den günstigen Ausgang, den er selbst sehnsüchtig herbeiwünsche: aber erst, wenn ich eine gesicherte Existenz habe. Die, denke er – und er habe darüber mit Grethe gesprochen, die völlig seiner Meinung sei – könne ich mir dadurch erwerben, daß ich in das Geschäft des Herrn Brünn einträte! – Ich wußte, als ich das las, zuerst nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Daß mein Vater immer noch solche Ideen über meine Zukunft haben kann, brauchte mich schließlich nicht zu wundern. Er schreibt auch diesmal wieder, daß, wenn ich seinem Rat folge, mein „fruchtloses Experimentieren“ der letzten 12 Jahre endlich vorbei sein werde. – Aber daß Grethe, von der ich immer einiges Verständnis für mich vorausgesetzt hatte, der gleichen Meinung ist, wie er, das ist entsetzlich. Also meine „Nächsten“ halten es für einen Fortschritt, für einen Aufstieg für mich, wenn ich nach zwölfjährigen Entbehrungen, nach einem Kampf voll Aufregungen, Opfern, ungeheuren Anstrengungen, nachdem ich mir gegen die unglaublichsten Widerstände eine geistige Position in der Welt geschaffen habe, wenn ich jetzt – Getreidemakler in Eydtkuhnen würde! Ich schäme mich für meine Schwester und meinen Vater vor denen, die später einmal diese Aufzeichnungen lesen werden. Was wird erst Jenny sagen, wenn sie das erfährt!
Was andres! Was soll ich mich fortwährend ärgern und grämen? Was soll ich fortwährend überlegen, daß nun das gute Gefühl, das hoffte, dem Vater nun doch endlich ein langes Leben wünschen zu können, wieder falsch war, und daß jede Aeußerung des Mannes, der wie ein Henkerstrick meine Seele einschnürt und mir mein bestes Leben ersticken will, mir beweist, daß unser beider Dasein ein Kampf auf Leben und Tod ist, und daß dieser Kampf, der nur in Gedanken und Gefühlen geführt werden kann, mich zwingt, inbrünstig den Tod des Vaters zu ersehnen, der die Bedingung meines Lebens ist. Ich mag die Dinge drehen und ansehn wie ich will – das bleibt immer wieder das Resultat: erst wenn der Vater gestorben sein wird, werde ich anfangen können, so zu leben, wie es für mein inneres und äußeres Heil nötig ist. Und diese Behandlung ist leider immer wieder durchsetzt mit einer heillosen Angst, ich könnte vorher sterben und mein Lebenswerk wird unverrichtet bleiben. Meine Hoffnung ist jetzt Jenny. Wüßte ich nur erst, wann endlich ich sie wiedersehn werde. Ob sie es wahr machen wird, im Oktober auch gegen den Willen ihrer Eltern zu mir nach München zurückzukehren? Ich hoffe es, und ich traue ihr es zu. Jenny! Geliebte.
Merkwürdig: solange sie hier war, glaubte ich wirklich, mich nun auf monogamischer Liebe zu erwischen. In den ganzen letzten Wochen kam mir kein geringstes Gelüst auf, meine Erotik auch nach andern Seiten zu strecken. Erst jetzt, in den allerletzten Tagen, spüre ich wieder den alten Wüstling in mir aufwachen. So habe ich ein Modell „Willy“, das im Café Stefanie seit einiger Zeit aufgetaucht ist, eingeladen, mal bei mir zu essen: ein hübsches Mädel, mit kurzen schwarzen Haaren. Ferner habe ich mit Lotte eine Vereinbarung getroffen, daß sie in diesen Tagen mal zu einem Piacere zu mir kommen wolle, und eben, als ich schon beim Einschreiben hier war, erschien plötzlich Frau Margot Jung und bat mich, bei mir essen zu dürfen, da sie Hunger habe. Wir küßten uns reichlich, und hätte sie nicht grade ihre „Gschicht“, dann wären wir sicher miteinander ins Bett gestiegen. Aber ich glaube, das wird nun doch bald geschehn, und ich ängstige mich nun nicht mehr davor, denn daß ich mich wieder in Mariechens Reize verliere, das wird meine Liebe zu Jenny bestimmt zu verhindern wissen. Den ersten Kuß seit Jennys Abreise erhielt ich gestern nachmittag von Anny Rosar. Ich hatte in der Torggelstube Mittag gegessen und sie dort getroffen. Wir gingen miteinander ins Café Orlando di Lasso, wo Frl. Elinor Bühler vom Künstlertheater sich mit ihrem Bräutigam einfand. Nachher begleitete ich die Rosar zu Besorgungen und dann in die Türkenstraße heim. Sie forderte mich auf, noch zu ihr hinaufzukommen, und oben fielen wir uns um den Hals und küßten uns. Ich machte keine weitergehenden Versuche – vielleicht aus Moral nicht, vielleicht weil ich sie instinktiv für vergeblich hielt, vielleicht auch nicht, weil ich schnell heim wollte, arbeiten. – Ich fing dann den Artikel über den „Kondor“ an, der heute fertig werden soll. Bloß noch von einem Theatererlebnis will ich berichten, dann gehe ich schleunigst an die weitere Arbeit.
Vorgestern war ich in der „Schönen Helena“. Vorher hatte ich Pallenberg gesprochen, der wieder sehr über die Langweiligkeit klagte, fortwährend die gleichen Sachen spielen zu müssen. Da er nun aber wußte, daß ich im Theater war, spielte er den Menelaus ganz für mich und war köstlicher, als ich ihn jemals sah. Er brachte es fertig, meinen Namen von der Bühne her zu nennen. Als ein Dichter geraten werden soll, meinte er: „Vielleicht Mühsam? Erich?“ – Und Zettl, der den Calchas spielte, wies, als sich jemand vor Furien fürchtete, ins Publikum auf mich, und sagte: „Das ist doch keine Furie. Das ist ein Bekannter von mir.“ Die Aufführung war im ganzen schlechter als die im Vorjahr. Ritter war durch Albert, die Jeritza durch die Nagel sehr übel ersetzt. Dagegen war Zettl weit besser als Charlé, und Ellen Richter unvergleichlich lieblicher als Orest als seinerzeit Camilla Eibenschütz. Vorher hatte ich die Richter auf seltsame Art kennengelernt. Ich stand mit Erich Zettl vor dem Theater, als eine Frauenstimme sehr laut rief: „Du, Erich, kannst du mir nicht ein Zweimarkstück in zwei Markstücke wechseln?“ – Ich griff in die Tasche, sah mich um und sagte: „Gewiß kann ich das. Hier!“ Gleichzeitig stellte ich mich vor. Ohne Verlegenheit sagte das junge Mädchen: „Sie waren zwar nicht gemeint. Aber die Hauptsache ist, daß mein Zweck erreicht ist. Ich heiße Ellen Richter!“ Darauf gaben wir uns die Hand. – Nach dem Theater ging ich mit Strich, Lotte und Kalser zu Kurtz essen. Dort fing aber die Zahnentzündung derart an zu schmerzen, daß ich bald allein aufbrach und heimging. –
Gestern war „Oaha“-Premiere im Lustspieltheater. Es gelang mir nicht, noch hineinzukommen. Aber nachher war in der Torggelstube großer Betrieb und sehr gute Unterhaltung, an der sich Wedekind, Blei, Kutscher und ich beteiligten. Blei war in großer Form und redete viel Blödsinn aber voll Idealismus. Er gefiel mir gut. Auch Tilly Wedekind war dabei. Sie sah entzückend aus. Ferner Jakob Tiedtke, der einen Vollbart trägt, und sich infolgedessen für seinen Bruder ausgab. Er spielte die Rolle seines eignen Bruders ganz konsequent und sehr lustig. Ich ging nachher mit Schwaiger nach Hause. Es war ein sehr schöner angeregter Abend gewesen, wie er jetzt leider in der Torggelstube so sehr selten geworden ist. Ich muß jetzt sehr darauf halten, meine Stunden und Tage in guter Unterhaltung und Beschäftigung hinzubringen. Die Sehnsucht nach Jenny und die Sorge um unser gemeinsames Schicksal droht sonst, mich ganz melancholisch zu machen.
München, Sonnabend, d. 10. August 1912.
Es ist wirklich eigentümlich: Früher fehlte mir etwas, der Tag kam mir unausgeglichen vor und ich hatte das Gefühl, als ob ich eine Pflicht versäumt hätte, wenn ich mal einen Tag nichts ins Tagebuch schrieb. Jetzt laufe ich tagelang herum und denke garnicht an dies Heft. Jenny erfüllt mich in der Tat so, daß ich fast nur noch an sie denke und mich nach ihr sehne, und was ich ihr zu sagen und mit ihr abzumachen habe, lasse ich lieber in Briefen an sie aus als in Tagebuch-Einzeichnungen. Vorgestern kam ein Brief von ihr – über 13 Seiten lang –, in dem sie über die Gründe berichtete, die ihre Eltern vorläufig noch zu der Weigerung bestimmen. Ich bin zu alt für Jenny und die Mutter hat geäußert, bei meinen 34 Jahren werde für sie nichts mehr übrig bleiben. Die Hauptsache ist natürlich aber mein geringes Einkommen. Jenny meint, ich solle mir von Papa die Zinsen der Häuser notariell verschreiben lassen. Ich mußte sie inzwischen leider über Papas Standpunkt aufklären. – Gestern ein weiterer Brief, in dem sie mir ausführlich eine neue These Franz Oppenheimers mitteilt, der das Avenariussche „Prinzip des kleinsten Kraftmaßes“ der ganzen Nationalökonomie zugrunde legen will. Sie knüpft sehr kluge durchdachte Erörterungen daran. Ich habe ihr ausführlich geantwortet.
Um zu andern Dingen zu kommen: Vorgestern war ich im Lustspielhaus und sah Wedekinds „Oaha“. Ich war sehr amüsiert. Es ist das schwächste Wedekindstück – sicher, aber doch immer noch ein ganzer Wedekind. Er selbst spielt den Sterner sehr flott. Doch störte mich, daß er den verstorbenen Albert Langen mit seiner hastigen Diskantstimme zu getreu kopierte. Tilly Wedekind war als Leona sehr sympathisch. – Ich habe die Frau so sehr gern. Es ist mein ganzer Wunsch, Jenny, wenn sie erst bei mir sein wird, als ihre Freundin zu sehen. Es wurde im ganzen gut gespielt. Einzelleistungen waren nicht besonders bemerkenswert. – Natürlich hat Wedekind schon wieder Krach mit Robert. Die beiden Herren lassen – wegen „Franziska“ – täglich Erklärungen gegeneinander in den Zeitungen los. Was eigentlich zugrunde liegt ist noch nicht zu übersehn. Es scheint aber, als ob Wedekind ohne zureichende Ursache beleidigt und empört ist. – Nach dem Theater ging ich in die Vierjahreszeiten-Bar, wohin mich Siegfried Jacobsohn bestellt hatte. Er saß dort mit Egon Friedell, und es war sehr lustig. Nachher kam noch Barnowsky, den Rössler sehr charakteristisch den „jüdischen Badeengel“ nennt. Er redet mit viel Prätention viel dummes Zeug zusammen. Nachher ich allein in die Torggelstube, wo ich Wedekind und Rössler antraf. Rösslers Benehmen gegen mich ist ganz verwandelt. Er lud mich auf das Herzlichste nach Starnberg ein, und wiederholte das heute für Montag zum Essen. „Ich muß zwar um 4 Uhr fort. Du kannst dann ja aber noch beim Consul bleiben.“ Ich war höchlich überrascht. – Gestern abend war ich in der Torggelstube allein mit Anny Rosar beisammen. Sie klagte sehr über Barnowsky, der ihr versprochen habe, sie solle bei ihm in Thomas neuem Stück „Magdalena“ die Hauptrolle spielen und sie nun wochenlang ohne Bescheid lasse, obwohl sie die Rolle studiert habe für ihn. Auf dem Nachhauseweg sprach sie fortwährend von Barnowsky, sodaß ich aufmerksam wurde. Sie lenkte mich am Hotel Continental vorbei und veranlaßte mich, dort zu fragen, ob B. nach Hause gekommen sei. Noch nicht. Also habe er sie nicht angelogen, als er ihr mittags telefonisch erzählt habe, er müsse nach Tegernsee zu Thoma hinaus. Ich sagte: wenn er nicht in der Odeon-Bar sitzt. Es ließ ihr keine Ruhe. Wir wollen „nur mal durchschauen“. Gleich neben dem Eingang saß eine Riesengesellschaft: Thoma, der ganze Simplizissimus, Erler und – Barnowsky. Wir gingen vorbei und tranken an einem versteckten Tisch eine Flasche Wein. Dann berichtete sie mir. An dem Abend, wo sie mit der Breda und Barnowsky zusammen in der Torggelstube gewesen war – ich war dabei gewesen – habe Barnowsky sie heimbegleitet – und sie habe ihn sich genommen, ohne zu bedenken, was sie anrichtete. Er renommiere damit, daß er noch nie zu einer seiner Schauspielerinnen intime Beziehungen gehabt habe und werde, um sich in seiner Direktorwürde nichts zu vergeben, ihr die Rolle, die ihren Ruhm in Berlin begründen sollte, wegnehmen. Ich mußte sehr trösten. Um ½ 3 Uhr lieferte ich sie vor ihrem Hause ab, und ging noch ins Stefanie, wo ich mit Bruno Frank zusammen war, der wie eine Leiche aussah. Es ist ihm – ich glaube, zum dritten Male – seine Geliebte gestorben ... Heut mittag traf ich im Stefanie Jacobsohn, den ich bis vor Wedekinds Tür brachte. Dort ist er zum Mittagessen eingeladen. Morgen fährt er ab. – Ich hoffe, daß sich das Wetter in diesen Tagen bessern wird. Dann will ich viel im Freien sein und meine Nerven zu reparieren suchen. Sie haben es sehr nötig.
München, Sonntag, d. 11. August 1912.
Von Jenny heute keine Nachricht. Aber aufgeregte Träume, die sich mit ihr beschäftigten. Übrigens spricht man schon in ganz München davon, daß ich heiraten will, obwohl ich nur mit Rössler davon geredet habe. Gestern abend tauchte Grete Berger in der Torggelstube auf, die sehr lieb aussah. Sie hatte von Liesel Steinrück in Tutzing von meinen Plänen gehört. – Ich hätte noch einiges nachzutragen, was ich gestern vergaß. Vorgestern abend war Albert R. da. Er aß bei mir Abendbrot und erzählte manches, was mich interessierte. Vor allem: Margrit Faas ist frei, (das wußte ich schon von Tobler und Landauer). Frick, der längst frei war, ist aber wieder verhaftet, schon seit drei Wochen. Die Gefahr soll aber nicht mehr so groß sein, wie vorher. Die arme Frieda! – Ich denke jetzt viel an sie, mit ruhiger guter Liebe. Ich möchte sie furchtbar gern wiedersehn und mit ihr über meine Herzensangelegenheiten sprechen. Ich bin überzeugt, daß sie sehr lieb zu mir sein wird. Mein schönstes und stärkstes Erlebnis wird sie gewiß immer bleiben, und ich werde sie lieben solange ich atmen kann. – Jetzt aber beschäftigt mich Jenny mehr. Morgen hoffe ich bestimmt, Nachricht von ihr zu finden – und hoffentlich gute.
München, Dienstag, d. 13. August 1912.
Alles vergesse ich, hier zu notieren. Ich hole, was mir einfallen will, nach: Sonnabend: im Schauspielhause Premiere von Hellers „Ahnengallerie“, deren Uraufführung ich im November in Berlin sah. Durchschlagender Erfolg natürlich. Aufführung mäßig. Heller als Urahn ganz gut, Randolf als sächsischer Arzt zum Speien miserabel ... Sonntag brachte ich den entsetzlichen Nachmittag – es regnete, die Caféhäuser waren überfüllt, zuhause wars unerträglich, mit Messtaler Billard spielend im Hoftheaterrestaurant zu. Im Stefanie erfuhr ich dann, daß Heinrich Mann mich gesucht habe. Ich telefonierte ihn an und er lud mich zu sich ein. Auch Brantl erschien und wir soupierten in Manns Pension. Sehr gute Gespräche. Mann hat über alle Dinge die feinsten Urteile. Brantl erzählte von einem Privatgespräch, das er mit dem Polizeipräsidenten v. d. Heydte gehabt habe. Der habe sich außerordentlich lobend über den „Kain“ ausgesprochen und Brantl recht gegeben, der ihn für die beste existierende Zeitschrift erklärte. – In der Torggelstube traf ich dann Grete Berger, Lina Woiwode und – das Moggerl. Das sah sehr nett aus, war lebhaft und vergnügt und schimpfte auf die Ritscher und darüber, daß ich in der vorigen Kain-Nummer einen Artikel über sie geschrieben habe. Als ich über sie selbst – Johanna Terwin – einen viel längeren Artikel publizierte, sprach sie nicht, wie diesmal, von „Protektionswirtschaft“. – Gestern (Montag) war ich in Starnberg, wo ich gleich zu Rössler ging. Er war nicht zuhause, wohl aber der Consul mit Mutter. Consul sieht schlecht aus, hinkt noch, war aber sehr nett. Von Liebe zu Rössler ist bei ihr keine Spur. Sie sprach ganz in der Tonart über das Verhältnis wie früher, und, wenn ichs darauf angelegt hätte, hätte ich sie getrost küssen können. Sie erzählte, daß sie beide im Herbst heiraten werden. – Rössler trafen wir im Restaurant beim Mittagessen. Er war zu mir wieder ganz der alte. Nachmittags pokerten wir zu dreien bei 20 Pfennig Limit. Ich gewann 5 Mk 70. – Später – zum Kaffee – ging ich zu Gotthelf und Lottchen. Ich blieb bis zum letzten Zug, und traf dann noch in der Torggelstube große Gesellschaft: Grete Berger, Sidonie Lorm, Karchow, Heinrich Mann, Albu, Gottowt und B. v. Jacobi mit Frau. Wir fuhren alle zusammen ins Odeon-Casino, wo es bei Sekt sehr amüsant zuging. Als ich um 4 Uhr totmüde und ziemlich bezecht heimkam, hatte ich noch das Vergnügen, daß die Entreetür nicht funktionierte und weder von außen noch von innen aufzumachen war. Ich mußte das ganze Haus allarmieren, bis ich schließlich ins Bett kam.
Heut früh kamen nun endlich wieder Nachrichten von Jenny: zwei Briefe auf einmal. In einem setzt sie die theoretischen Erörterungen fort, im andern schreibt sie über den Stand der Dinge. Die Schwierigkeit liege nur noch im Finanziellen. Ihr Vater habe gesagt, er habe keine Lust, uns zehn Jahre lang den Lebensunterhalt zu verschaffen, und er sehe nicht ein, warum er einem Menschen sein Geld geben solle, dem der eigene Vater nicht hilft. Das arme Mädel scheint schon ganz konfus zu sein. Ich schrieb ihr sogleich. – Von Papa eine Postkarte, in der er – sehr liebenswürdig – nach dem Stand der Dinge fragt. Ich schrieb ihm – zwar diplomatisch, doch aber deutlich meinen Charakter betonend. – Grethe wehrt sich auf einer Postkarte sehr dagegen, daß sie Papa darin zugestimmt haben soll, daß ich Sozius des Eydtkuhner Schwiegervaters werden solle. Sie habe Papa darin sogar direkt widersprochen. Die Karte von ihr ist sehr nett. Sie stand mir von jeher von meinen Geschwistern am nächsten. Ich freue mich sehr darüber, daß Papas Behauptung falsch war. – Morgen erwarte ich von Jenny weitere Nachricht.
München, Freitag, d. 16. August 1912.
Jenny schrieb mir in einem ihrer Briefe, sie schreibe das, was sie bewege, lieber an mich, als in ihr Tagebuch. Mir gehts jetzt gradeso. Seit ich ihr fast täglich schreibe, vernachlässige ich wie nie in den letzten zwei Jahren diese Hefte. Aber für die nächsten Tage muß ich wohl wieder hierher zurückflüchten, da Jenny mir mitteilte, daß sie einen Besuch bei ihren Verwandten in Russland mache, und ich ihr während dieser Zeit nicht schreiben könne. So will ich das Versäumte aus den letzten Tagen heute kurz nachholen.
Dienstag: ich erhalte Besuch des Genossen Losch aus Luzern, der mir über den Stand der Schweizer Bewegung referiert. Erinnerung an meinen Luzerner Vortrag vor zwei Jahren, bei dem ich den Genossen so hart vor den Kopf schlug.
Mittwoch: abends in der Torggelstube sehr amüsante Stunden. Wedekind so aufgeräumt, wie ich ihn seit langer Zeit nicht sah, machte brillante Witze und poussierte heftig Anny Rosar, die dort – zum ersten Mal seit ihrem Abenteuer mit ihm – Barnowsky wiedersah. Mir als Eingeweihtem war die Situation sehr pikant. Possart- und Lautenberg-Anekdoten. Wedekind sagt von Possart, er sei der Erfinder des Münchner Fremdenverkehrs. Spät nach Hause.
Donnerstag: Ich hole, laut Verabredung, mittags Anny Rosar ab, um sie zur Bahn zu begleiten, da sie nach Starnberg zur Massary eingeladen war und mir noch über die Entwicklung ihrer Angelegenheit mit Barnowsky berichten will. (Die Sache ist geregelt. Sie wird Thomas Magdalena in zweiter Besetzung – nach Centa Bré – im Kleinen Theater in Berlin spielen). Am Bahnhof überredet sie mich mitzufahren. Charlé fährt mit uns. Wir trennen uns am Starnberger Bahnhof mit der Verabredung, daß ich die Massary im Laufe des Nachmittags anrufen soll. Ich esse bei Pellet-Maier Mittag, suche dann vergeblich Rössler und Gotthelf, die beide in Riem zum Rennen waren (gestern war Feiertag: Mariä Himmelfahrt). Auch der Consul und ihre Mutter sind nicht aufzufinden. Ich telefoniere die Rosar an und werde dringlich eingeladen. Fritzi Massary bewohnt mit Pallenberg zusammen (sie wollen demnächst heiraten) die Villa Ammann weit draußen in der Possenhofenerstrasse. Ich gelange in scharfem Tempo in einem halbstündigen wunderschönen Spaziergang hin, auf der Landstrasse schon empfangen von Pallenberg, der Rosar und der Massary, die ich jetzt erst kennen lernte, nachdem wir uns bisher immer nur von weitem sahen. Eine entzückende Person, schön, schlank, intelligent, lebhaft. Sie soll über vierzig Jahre alt sein. Man schätzt sie höchstens auf dreißig. Sie wohnen wunderschön, direkt am See, gegenüber der Gedächtniskapelle für Ludwig II., die die ganze Gegend verschandelt. Ich erhalte einen prachtvollen starken Kaffee und brillante Servelatwurst. Angeregteste Unterhaltung. Um 6 Uhr im Motorboot mit Pallenberg und der Rosar, die beide abends zu spielen hatten, zurück. Um 7 Uhr Ankunft in München, nachdem wir am Starnberger Bahnhof wieder Charlé getroffen hatten. – Ich habe mit Pallenberg und der Massary verabredet, daß ich ihnen einen Sketch schreiben soll, da sie vom Winter ab gemeinsam mit Sketchen in Varietés auftreten wollen. Das kann, wenn es glückt, eine ganze Menge Geld einbringen.
Abends wurde ich im Café Stefanie von Betty Seipp, dem Seppel, angerufen. Sie holte mich mit Auto von dort ab, und wir fuhren zusammen in die Torggelstube. Sie sah sehr hübsch aus, kam vom Gardasee und trug noch ein grünes Dirndl-Kostüm. Aber sie hat üble Eigenschaften angenommen, vor allem eine ganz blöde Bazillenfurcht, die sie fortwährend betont. Schade. Geld und Türklinken werden nur mit Handschuhen angefaßt und alles so albern wie möglich aufs Hygienische hin beurteilt. Nachher mußte ich sie im Auto heimfahren. Die beiden Autofahrten kosteten mich über vier Mark, und nun bin ich so ziemlich wieder am Ende meiner Geldmittel angelangt. Es ist recht trübselig. Morgen werde ich nichts mehr haben.
Von Jenny nichts Neues. In der Sache kein Schritt weiter. Aber heute von Onkel Leopold eine Postkarte, ich solle ihm umgehend (unterstrichen) über den Stand der Angelegenheit berichten. Vielleicht weiß er etwas Neues und Gutes? – Ich habe ihm geantwortet. Er hat noch immer geholfen. Vielleicht bewährt er sich diesmal besser und freundschaftlicher als mein reicher Vater mit seinen gefesteten Grundsätzen.
München, Sonnabend, d. 17. August 1912.
Ich bin in einiger Sorge um Jenny. Seit Mittwoch habe ich keine Nachricht von ihr, und jüngst schrieb sie mir, daß sie sich krank fühle. Schreiben kann ich ihr jetzt garnicht. Sie hat es ausdrücklich verboten, da sie für einige Tage nach Russland wolle, und inzwischen das Briefgeheimnis in Eydtkuhnen nicht ganz gesichert sei. Nun hoffe ich nur, daß morgen ein Brief ankommt. Sonst fürchte ich entsetzliche Nerventorturen.
Gestern mittag bestellte mich Seppel telefonisch ins Luitpold. Während wir dort saßen, erschien plötzlich Ilona Ritscher, die sich nochmals höchlich für meine Kain-Notiz bedankte. Sie sah sehr nett aus. Angeblich ist es doch noch nicht ganz ausgeschlossen, daß sie hier engagiert wird. Speidel selbst hat sie noch garnicht gesehn. – Sie erzählte auch, daß sie in Berlin am Kleinen Theater in Thomas „Magdalena“ die Titelrolle spielen werde, und zwar in erster Besetzung. Ob sie statt der Bré dazu berufen ist, oder ob man der Rosar oder der Bré oder ihr oder noch diversen Frauen etwas vorgeschwindelt hat, wird sich ja herausstellen. Ich werde der Rosar nichts sagen, um sie nicht aufzuregen. Aber Barnowsky scheint mir da kein ehrliches Spiel zu treiben. – Heute vormittag sollte ich die Ritscher im Hotel Vier Jahreszeiten anrufen, verschlief aber. Sie war schon ausgegangen. – Ich machte dann also nach dem Luitpold mit Seppel einen ziemlich weiten Spaziergang durch den Englischen Garten, wobei sie mir weit besser gefiel als vorgestern. Vor allem sah sie entzückend aus. – Abends war ich dann allein im Künstlertheater, um die Massary als Helena zu sehn, die sie zum letzten Mal sang. Sie ist unvergleichlich besser als die Nagel und kann in mancher Hinsicht auch über die Jeritza gestellt werden. Pallenberg trieb wieder das Tollste. – Im Theater traf ich eine Dame, die ich im Fasching viel geküßt habe (im Luitpold), eine Bekannte aus der Gustav-Gross-Zeit, deren Namen ich mir nie merken kann. Durch sie lernte ich einen Wiener Herrn kennen, einen Bruder des verstorbenen Otto Weininger, einen netten feinen Menschen, der mir vom Kraus-Kreis erzählte. Die beiden brachten mich im Auto zur Torggelstube, wo gepokert wurde: Rössler, Gotthelf, Strauß, Charlé, Bernauer, Eyssler. An einem andern Tisch saßen die Ehepaare Wedekind und v. Jacobi mit Herrn Schröder (ehemals Schmutzler). Rosenthal kam, und ich setzte mich mit ihm zu Wedekinds Tisch. – Als Meinhardt erschien, nahm ich ihm sogleich 5 Mk ab, und als alle andern weg waren, ging ich an den Spielertisch zurück und gewann dort beim Baccarat, indem ich bei einem einzigen Coup setzte, 4 Mk. So bin ich für heute und morgen mal wieder gesichert, – und Montag denke ich dem „Simplizissimus“ mal wieder einen Besuch abzustatten.
München, Sonntag, d. 18. August 1912.
Was hat das zu bedeuten? Von Jenny immer noch kein Brief! Ich bin sehr beunruhigt, zumal ich kaum eine andre Erklärung finde, als daß sie krank sein muß. Ist morgen keine Nachricht da, so schreibe ich trotz ihres Verbots. – Zu all den Unsicherheiten und Sorgen nun auch noch die Unterbrechung der Verbindung: es ist bald nicht mehr zu ertragen. Ich fürchte ernstlich für mein Herz, das ich jetzt häufig spüre.
Inzwischen lebe ich hier in ewiger Abwechslung, wie immer, wenn ich mit der Seele sehr beschäftigt bin, der Körper Zerstreuung braucht. Gestern nachmittag traf ich im Stefanie Gustav Lewitzky mit Asta, die ich seit fünf Jahren nicht sah. Sie hat sich wenig verändert, die feinen Glieder der Turkestanerin entzückten mich wie ehedem und ich hörte interessiert, daß die beiden eine vierjährige Tochter haben, und daß Asta sich Lewitzkys Wunsch, sie zu heiraten, mit großer Hartnäckigkeit widersetzt, weil sie den Staat nicht als Zeugen ihres Privatlebens dulden will. Ich führte die beiden durch München, und zeigte ihnen unter anderm den alten Turnierhof in der Münze, den ich bei dieser Gelegenheit auch erst kennen lernte. Ein wundervolles Renaissancedenkmal, wie ich es in solcher stilreinen Schönheit nicht zum zweiten Mal kenne. Ich war dann im Hofbräuhaus und noch einmal im Stefanie mit ihnen, und lieferte sie um 10 Uhr vor der Bonbonnière ab, während ich in die Torggelstube ging. Gotthelf mit Lottchen, Falkenstein, Strauß, Frau Victor Léon (eine aufgedonnerte Wienerin) mit zahllosen Brillanten und ganz hübscher Tochter, Charlé, Feldhammer, Sidonie Lorm, Graf Keyserlink. Wir alle gingen ins Odeon-Casino, wo viel getrunken wurde. Gegen 5 Uhr kam ich ins Bett, wachte aber schon früh auf, da mich die Aufregung, ob Jenny endlich Nachricht geben werde, nicht schlafen ließ. Gebe Gott, daß ich bald beruhigt werde. Meine Nervenverfassung läßt eine lange Fortdauer dieser zweifelsvollen Zeit kaum noch zu.
München, Dienstag, d. 20 August 1912.
Ein Brief Jennys von zauberhafter Süßigkeit und Güte brachte mich gestern ganz aus dem Häuschen. Das süße geliebte Wesen! Sie muß mich wohl sehr lieb haben, daß sie Worte findet, die mich im Tiefsten rühren und beglücken. Daß sich unsrer Verbindung solche Widerwärtigkeiten entgegenstellen! Das Verhalten meines Vaters wird mir immer unerklärlicher. Mit 21 Jahren mußte ich den Verzicht auf die großväterliche Erbschaft unterzeichnen – was wäre wohl geschehn, wenn ich es nicht getan hätte? Pflichtteil wäre das wenigste gewesen. Sicher hätte man auch Kuratel-Gründe gefunden. Aber daß er die Macht, die ich ihm dadurch in die Hände gab, dermaßen mißbrauchen könnte, das hätte ich doch nicht für möglich gehalten. Daß er mich – den Besitzer von Hunderttausendmark-Werten – hungern ließ und mir dann ein Butterbrot – von meinen Zinsen – gnädig gewährte, ist noch verständlich, da er sich in meinem ganzen Wandel in seiner väterlichen Autorität beleidigt fühlte. Schön war gewiß auch das nicht. Aber jetzt, wo ich seinen Herzenswunsch erfüllen will, wo ich eine Frau nehmen will, die ihm völlig genehm ist, läßt er das womöglich daran scheitern, daß nicht ich der Herr meines Vermögens bin sondern er. Es ist hassenswert. Wie kann der 74jährige herzkranke Mann nur am Ende seiner Tage noch so den Wunsch im eignen Sohn nähren, daß das Ende recht schnell komme? Geiz ist doch keine Erklärung – ich weiß aber keine bessere, es sei denn die wahnsinnige Angst, wieder ein Stückchen seiner Vatermacht aus den Fingern geben zu sollen. Wenn er doch noch ein Einsehn hätte! Ganz gebe ich die Hoffnung immer noch nicht auf, daß er vielleicht doch noch durch einen plötzlichen Entschluß mein Glück herbeiführt. Es wäre so schön, ich wäre ihm so dankbar und gönnte ihm dann aus wirklich ehrlichem Herzen noch lange gesunde frohe Lebenszeit.
Was in München geschieht, lohnt mir jetzt gegenüber dem starken inneren Erlebnis kaum der Erwähnung. Nur des Zusammenhangs wegen mag einiges notiert werden, einige Namen wenigstens: Sonntag abend erschienen in der Torggelstube wieder Frau Victor Leon mit Tochter und Schwiegersohn, einem Wiener Tenor, ich glaube er heißt Maruschek. Die Damen aufdringlich und geschmacklos mit den protzigsten Kostbarkeiten behängt. Ein einziger von den Brillanten der Frau Leon – erworben durch schlechte Operettentexte – würde vielleicht genügen, um Jennys und mein Eheglück zu begründen. Die Leute waren mir recht unsympathisch, und ich war froh, als Frau Schwab und Rosa Valetti kamen, die eben von Ischl zurück kam und nur auf der Durchreise hier ist. Sie hatte eine Frau Direktor Charlé bei sich, und als nachher Charlé kam, war es sehr spaßig zu sehn, wie er zurückschrak, sich verbeugte und bei einer andern Gesellschaft Platz nahm. Es war nämlich seine jüngst geschiedene vierte Frau, und er ist grade im Begriff, für einige Zeit die fünfte zu heiraten. – Die Valetti, die in ihrer grotesken Schlampigkeit sehr lustig von den Wiener Damen abstach, tat mir mit ihrer humorvollen Unterhaltsamkeit wahrhaft wohl. – Gestern mittag traf ich im Hofgarten alte Bekannte: Kurt Hermann Rosenberg und Frau Ilse, die entzückend aussah. Gösch mit Frau und Bruder und Geyer, der Indienreisende. Sie sind alle zum Theosophenkongreß hier. Große theoretische Erörterungen über ihren Spezialgegenstand. Mich freute am meisten das Wiedersehn mit Ilse; wir nannten uns nach einigem Zögern Du. – Als ich von dort ins Café Bauer wollte (das Stefanie ist wegen Renovierung seit gestern geschlossen), traf ich Mariechen. Sie kam zu mir hinauf und lieh sich von neuem mein Handtäschchen aus, da sie aus ihrer Wohnung rücken wollte. Ich bekam ein paar Küsse. Aber ich küßte mehr aus Höflichkeit als aus Drang. Mariechen gefiel mir nicht besonders. – Abends im Torggelhaus erschien Langheinrich und Frau. Ich überließ aber die beiden Herrn Alfred Holzbock, der herankam und setzte mich ins Nebenzimmer, wo Käte Richter mit ihrem Direktor und Freund Herrn von Rehlen, dem Leiter der Wiener Residenzbühne Platz genommen hatte. Ich freute mich sehr über das Wiedersehn. Es ist schon ganz toll, wieviel Bekannte von Berlin und Wien man um diese Jahreszeit in München trifft. – Heut vormittag suchte ich den Simplizissimus auf. Geheeb war verreist. Ich traf Gulbransson an und Dr. Bleich, der jetzt Redaktion führt. Er zahlte mir für drei Witze 30 Mk aus. Es war höchste Zeit. – Als ich nach Tisch das Haus verlassen wollte, kam die Treppe herauf mir entgegen Peter Beutler, um mich zu besuchen. Ich freute mich riesig über den Jungen, nahm ihn noch erst ins Zimmer und dann zum Hofgarten. Unterwegs trafen wir Lotte. Peter ist ein reizender offener strammer Bengel. Ich führte ihn und das Puma dann noch in ein Kinematographentheater und Peter dann auch noch ins Café Bauer, wo er kurz vor sieben Uhr erst mich verließ. – Doch saß dort Rudolf Klein aus Berlin, der Mann der Wolfthorn. Wir sprachen über Lentrodt und andre Bekannte. – Heut abend soll ich in der Torggelstube mit Herbert Eulenberg zusammensein, der Sonntag noch hineinschaute, aber angesichts der Damen Leon schleunigst floh.
München, Mittwoch, d. 21. August 1912.
Heute kamen gleichzeitig zwei Briefe an: einer von Papa, einer von Jenny. Ich öffnete den aus Lübeck zuerst. Das wollte ich überstanden haben, ehe ich meine Seele den Küssen der Geliebten freigeben wollte. Welch ein entsetzlicher Brief ist das wieder. Ich seh es immer deutlicher und sicherer, daß mich von meinem Vater ganze Zeitalter scheiden. Er antwortet mir auf meine letzten Darlegungen. Ich hatte ihm vorgerechnet, daß die Zinsen von Jennys Mitgift, sein Zuschuß und meine Einnahmen je 100 Mk monatlich betragen und hatte gehofft, er werde jetzt endlich erklären, daß er sich zu einem höheren Zuschuß verstehn werde, der uns über ernste Schwierigkeiten hinweghelfen müßte. Kein Gedanke. Er ist nur empört darüber, daß ich bloß 1200 Mk im Jahre verdiene – wenn er eine Ahnung hätte, daß diese Summe schon sehr hoch gegriffen ist! – und rechnet mir vor, was andre Leute einnähmen: Subalternbeamte, ausgelernte Krämerlehrlinge, Büroschreiber, Bäcker- und Tischlergesellen, junge Apothekergehilfen, Kanzleiboten und Aktenträger – diese Berufe hält er mir entgegen, und ist natürlich der Meinung, daß eine Arbeit eben grade soviel wert ist, wie man dafür zahlt, meine Tätigkeit also so viel wie garnichts. Ich solle also den Schwiegereltern erst mal ein genügendes Einkommen nachweisen und bis dahin auf alles Glück warten. – Nun, so muß ich eben versuchen, auf andre Weise mit der Angelegenheit ins Reine zu kommen. Vorläufig hoffe ich, daß Herr Brünn sich selbst zu einer Beleihung meiner Erbschaft entschließen wird. Damit verliert er kein Geld und Jenny und mir wäre geholfen. – – Und dann also der Brief von Jenny. Das geliebte Geschöpf! Sie schreibt viel über ihr eignes Wesen und ihre Stellung zur Gesellschaft, viel Kluges und Feines und will mir dann beweisen, daß sie nicht mehr sei, als alle ihre Freundinnen, da sie ja auch ununterbrochen Kompromisse machen müsse und fortwährend sich verstellen muß, damit man sie – falsch verstehe. Ja, ja Liebes. Der Unterschied ist nur der, daß Du darüber nachdenkst und Dich kritisierst und die andern nicht. Und dieser Unterschied ist entscheidend. – Nachher noch sehr süße zarte Liebesworte, die mich immer wieder unsinnig glücklich machen. Ach, wie ich die Zeit herbeisehne, wo ich ganz mit der Geliebten vereint sein werde. Ich habe mich fast im Verdacht, daß ich ein sehr guter und vielleicht sogar treuer Ehemann sein werde. Wärs nur erst soweit!
Ich setze den Tatsachenbericht fort und gelange natürlich damit zur Torggelstube. Wedekind war nicht dort, da ich verbummelt hatte, ihn von Eulenbergs Anwesenheit zu verständigen. Dagegen waren zurstelle: Eulenberg, Dr. Emil Milan, Steinrück, v. Jacobi und Frau, Etzel und Frau, Oppenheimer und Holzbock. Holzbock, der kein Fremdwort richtig ausspricht und andauernd alte jüdische Witze erzählt, hatte anfangs, als er mit dem Ehepaar Jacobi und mir allein war, behauptet, in München fehle in allen Unterhaltungen das Niveau, er höre hier nur immer Privatklatschereien. Nachher ödete er die ganze Gesellschaft entsetzlich mit seinen Anekdoten. Einmal flüchteten Eulenberg und ich auf den Lokus. Da funktionierte das Licht nicht. Herr Rauschenbusch leuchtete uns deshalb mit einer Kerze. Er benutzte die Gelegenheit, uns ebenfalls eine Anekdote zu erzählen. Wir waren vom Regen in die Traufe geraten. Endlich ging Holzbock fort, und jetzt kam mit einemmal eine ausgezeichnete Unterhaltung in Fluß über die Frage, ob ein Mensch, der imstande ist, von großen Bühnenaufgaben fort zur faden Operette zu gehn, blos um Geld zu verdienen, jemals wieder zur Kunst zurückkönne. Steinrück vertrat gegen Jacobi und Milan den rein idealen Standpunkt. Das Gespräch, das natürlich zu keiner Klärung der Frage führte, war mir sehr lehrreich und psychologisch bedeutend. – Schließlich wurde es sehr lustig, es wurde Sekt getrunken, gesungen und um ½ 4 trennten wir uns. Oppenheimer brachte mich per Auto heim.
München, Donnerstag, d. 22. August 1912.
Diese Tagebücher feiern heute ihr zweijähriges Jubiläum. Es war doch eine sehr gescheite Idee damals im Sanatorium, sie einzurichten. Es ist in den zwei Jahren viel in mir und um mich geschehn. Menschen sind an mir vorübergegangen, Ideen sind gereift, – ich habe den „Kain“ gegründet, allerlei geschrieben und gestaltet, Frauen haben in meinen Armen gelegen – und jetzt stehe ich vor dem großen Wendepunkt meines Lebens, wo ich mein Schicksal dauernd mit dem eines sehr geliebten Weibes vereinigen will. In den Tagebüchern kann ich all die Entwicklungen so ganz genau zurückverfolgen, von ihren ersten Anzeichen an bis zum Erfolg oder bis zum Débacle. Jeden Tag lese ich, was ich vor einen Jahr schrieb (von heute ab werde ich nun auch die Notizen nachlesen, die ich vor zwei Jahren schrieb) – und so erhält sich mir die Erinnerung auch an kleine Einzelheiten. Wie lange ich das Tagebuch noch so exakt führen werde, weiß ich natürlich garnicht. Eines Tages kann es plötzlich aufhören – ebenso wie ich eines Tages die Lust am „Kain“ verlieren kann.
Aber weiter im Text. Von Jenny heute keine Nachricht. Dagegen ein Brief von Dr. E. Preetorius, der mich veranlaßt, eine Tatsache hier nachzutragen. Vor einigen Tagen suchte mich der kleine Hörschelmann im Café auf, um mir – vor seiner Abreise – mitzuteilen, daß ein neues Zeitschriftenunternehmen im Entstehen sei, das Witzblattcharakter habe, über das er aber noch garnichts sagen dürfe, nur daß bereits 300.000 Abonnenten da seien, und daß man meine Mitarbeit wünsche. Emil Preetorius leite die Sache, ich solle ihm schreiben. Gleichzeitig skizzierte er eine Zeichnung von sich (drei alte Ritter), die ich textieren möchte. Das tat ich und schickte die Sache an Preetorius, von dem nun heute eine etwas vage Antwort kam: er danke mir für meine Bereitschaft und werde mich, wenn die Sache spruchreif ist, zur mündlichen Unterredung einladen. – Vielleicht kann sich da mal wieder eine festere Einnahmequelle aufschließen.
Eine sehr unangenehme Geschichte teilte mir gestern im Café Bauer Herr Lorenzen mit: Herr Gillardone habe einen Zivilprozeß. Bei einem Termin habe der gegnerische Anwalt ihn persönlich damit herabzusetzen versucht, daß er ihm seinen Verkehr mit mir vorwarf. Das soll in einer für mich beschimpfenden Form geschehen sein. Ich habe sofort an Gillardone, der zur Zeit in Diessen am Ammersee ist geschrieben, um den Namen des Anwalts und den Wortlaut seiner Aeußerung zu erfahren. – Obgleich ich sonst prinzipiell nicht klage, werde ich den Mann doch wohl vor Gericht zitieren, damit er seine Behauptung, ein anständiger Mensch könne mit mir nicht verkehren, an der Stelle wo er sie ausgesprochen hat, auch begründen kann. Ich werde jedenfalls als Zeugen für meine Gesellschaftsfähigkeit eine große Zahl Leute vorladen lassen: Literaten, Künstler, Professoren, Rechtsanwälte etc aus meinem Bekanntenkreis. Schließlich kann mich ja eine solche Niedertracht, wenn ich sie stillschweigend passieren lasse, unglaublich schädigen. Aber es ist schon recht ekelhaft, fortwährend gegen solche Minderwertigkeiten ankämpfen zu müssen.
Jetzt will ich – sobald ich gegessen habe – zu Georg Müller, der von seiner Reise zurückgekehrt ist, wie mir Reese gestern in der Torggelstube erzählte. Frisch berichtete mir jüngst im Café, daß er Müller die Annahme der Essaysammlung dringend empfohlen habe. Es wäre Zeit, daß ich mal wieder ein Buch herausbrächte und etwas größeres Geld in die Finger kriegte.
München, Freitag, d. 23. August 1912.
Von Jenny heute ein kurzer Brief. Danach ist sie nun wohl gestern wirklich nach Rußland gefahren und kommt Montag abend zurück. Sie meint, daß sich in der nächsten Woche alles entscheiden wird, da ihr Vater nachgrade einzusehn scheint, daß ihm nichts andres übrigbleibt als nachzugeben. Dann wird aber erst mal die Verlobung offiziell sein – und ich werde, komisch genug! – richtiggehender Bräutigam sein. Es ist schon merkwürdig, daß ich antigesellschaftlicher Mensch in allem was ich unternehme, ganz korrekt die gesellschaftlichen Konventionen wahren muß. – Daß wir sie schon nicht mehr gewahrt haben, sondern die Ehe vor der Verlobung eingeleitet haben, erfährt ja niemand. Wäre nur endlich erst alles geklärt! Wäre nur endlich erst alles vorüber und in Ordnung!
Müller war gestern nicht zu sprechen. Ich hoffe, ihn heut zu erreichen. Heute scheint ein guter Tag zu sein. Ein überraschendes 20 Markstück ist wieder in meiner Tasche, nachdem ich von dem Simplizissimus-Honorar gestern das dritte und letzte Zehnmarkstück gewechselt habe. Mit der Frühpost kam nämlich eine Zuschrift des geheimnisvollen Hörschelmann-Preetoriusschen Zeitschriftenunternehmens, aus der sich ergab, daß es sich um eine Erweiterung des längst bestehenden Organs „Zeit im Bild“ handelt. Der Chefredakteur, als der sich zu meiner Überraschung Herr Heinrich Michalsky entpuppte, lud mich zu einer Besprechung ein, und heute früh war ich da und erhielt zunächst für das Drei-Ritter-Gedicht 20 Mk. Montag soll ich zur Redaktionskonferenz kommen. Da wird sich dann weiterhin ergeben, ob aus dem Blatt eine dauernde Goldfontäne werden kann. – Inzwischen denke ich fortwährend über die Sketch-Idee für Pallenberg-Massary nach, aber noch ist mir nichts Rechtes eingefallen. Ich sprach gestern Etzel, der ebenfalls sich jetzt auf Sketche legen will und schon eins geschrieben hat. Der sagte mir, daß man 6000 Mark fordern kann. Blei hätte soviel gekriegt. Ferner schlug er vor, eine Reihe von Sketch-Fabrikanten solle sich zusammentun und ein gemeinsames Pseudonym wählen. Dieser Name würde dann ungeheuren Wert erhalten und man werde viel besser bezahlt bekommen als wenn man auf eigne Faust wirtschaftete. Der Gedanke ist diskutabel. Nur werden wohl eine ganze Reihe Schwierigkeiten in der Arbeitsverteilung, wenn Aufträge an den Namen kommen, erst geregelt werden müssen. Jedenfalls will ich bei der Aussicht auf so kolossale Bezahlung jetzt ganz intensiv über die Idee nachdenken. Es wäre ja ganz herrlich, wenn ich plötzlich meine Einkünfte zu solcher Höhe emporschrauben könnte, daß ich über die ungeheuerliche Härte meines Vaters achselzuckend hinweggehen könnte, und die Bedingungen, unter denen ich mit Jenny vergnüglich leben kann, mir selbst schüfe. Aber nur nicht zu früh optimistisch sein. Vielleicht geht alles schief.
München, Montag, d. 26. August 1912.
Also es ist abgemacht: meine moralische Standhaftigkeit ist erschüttert. Für Jenny ist provisorischer Ersatz eingestellt: Grete Krüger wird mein Ferienverhältnis. Freitag abend – ich ließ ihretwegen die Gruppe im Stich – war sie bei mir, um Gedichte von mir sich zum Vortrag auszubitten. Als ich sie küßte, bot sie mir direkt an, mir beim Aufräumen meines Zimmers zu helfen, und als ich ihr sagte, ich dächte daran, mir eine Wohnung einzurichten, wollte sie gleich alle Arbeit dabei übernehmen. Ich klärte sie deshalb darüber auf, daß ich heiraten möchte, was sie sichtlich traurig stimmte. Aber sie ist auch nur Strohwitwe, und zwar doppelt. Sowohl Bloch, der zur Zeit in Amerika ist, wie auch ihr eigentlicher Verlobter, ein Grieche, will zurückkommen oder sie zu sich kommen lassen und womöglich heiraten. So einigten wir uns auf Liebe für Zeit. Natürlich hatte auch sie grade ihre „G’schicht“, und so begann die Liebschaft mit jener liebenswürdigen Aushilfsmaßnahme, deren sich Zaza in solchen Fällen zu bedienen pflegte, und bei der nur ich auf die Kosten komme. In zwei bis drei Tagen hoffe ich sicher auf die erste Nacht. – Meine Gefühle zu Jenny werden wohl durch dieses Provisorium wenig tangiert werden. Was mich mit Jenny verbindet, ist denn doch etwas so andres, größeres und tieferes, daß ein Techtelmechtel auf rein sexueller Grundlage schwerlich dagegen aufkommen kann. Natürlich werde ich Jenny nichts auch nur Andeutendes schreiben. Aber später darf sie gern alles erfahren. Wer weiß, ob sie selbst all die Wochen der Trennung hindurch mir die monogamische Treue hält? Sie weiß, daß ich es nicht von ihr verlange.
Vorgestern und gestern war ich in Starnberg. Rößler traf ich nicht an, sprach aber den Consul. Die beiden sind gestern früh für drei Wochen nach Gastein gefahren, wo Consuls Fuß nun endlich ganz geheilt werden soll. – Ich war bei Gotthelf und Lottchen, die sehr gastfrei waren und mir sogar für die Nacht ein Zimmer mit schönem Bett zur Verfügung stellten. Gotthelf ist ein grundanständiger Mensch, nur wirkt seine Unterhaltung auf die Dauer recht langweilend. – Die freie Luft, und gestern das Schwimmen im Undosa-Bad taten mir sehr wohl, obwohl das Wasser des Starnberger Sees abscheulich kalt war. Als ich gestern abend heimkam, fand ich von Jenny einen Brief aus Rußland vor. Heute dürfte sie in Eydtkuhnen zurücksein, und im Laufe dieser Woche wird der alte Brünn nun wohl endlich Ja sagen und auch, trotz meines Vaters, die pekuniäre Frage der Angelegenheit günstig ausgleichen. – Ich ging dann noch spät in die Torggelstube, wo ich allein Fräulein Niklas antraf, die neue Operetten-Diva des Gärtnerplatztheaters, eine etwas gewöhnliche, aber nicht unsympathische, hellblonde und zu Fettansatz veranlagte Berlinerin mit schönen kleinen Händen. Ich führte sie noch ins Odeon-Café und hatte die Empfindung, bei einigem Bemühen würde sie sicher zu einem Piacere zu bewegen sein. Sie klagte sogar schon, daß sie, obwohl sie schon einen Monat in München sei, noch kein Verhältnis habe. – Ich beherrschte mich aber, zumal ich totmüde war. – Auf dem Nachhausewege blickte ich noch ins Café Bauer hinein, wo mir eine etwas phantastisch aufgemachte Gesellschaft auffiel, der ich von fern ansah: Theosophen. In dieser Gesellschaft erkannte ich – durch die Tür – Scharf und Frau, dann Dr. Ludwig und schließlich, zu meiner großen freudigen Überraschung – Fidus. Natürlich ging ich jetzt hinein. Fidus, den ich wohl 5 Jahre nicht mehr gesehn habe, war mit einer Freundin da, die ich gräßlich fand, alt, dürr, gespensterhaft, vergilbt, mit spitzig erhobenem Zeigefinger und Goldreif im Haar, dabei wallende Tunika – scheußlich. Fidus selbst ist in seinem lieben Gesicht und in seinem Gebaren unverändert, immer pendelnd zwischen einer feierlichen, fast weihevollen Sprache und ganz ausgelassener Witzigkeit. Dann war noch ein Oberstleutnantsehepaar dabei, von dem mir die Frau ungemein gut gefiel. Schön, klug und tief. – Ich kam sehr angeregt um 1 Uhr heim.
Von Johannes ein klagender Brief. Ich soll ihm diesmal das Geld bestimmt zum Ersten schicken. Wüßt ich nur, wie ichs mache. – Bücher will er, und ich habe keine Bibliothekskarte mehr. Ich möchte dem armen Freund so gern bald ausgiebig helfen können. – Pierre Ramus schickt mir sein Werk „Die Opfer und Märtyrer des Justizmordes von Chicago 11 November 1887“, herausgegeben durch die internationale Kulturgemeinschaft „Freie Generation“ in der Bibliothek der Anarchie. – Paul Zech schreibt einen netten Brief, in dem er mein Urteil über die Kondorleute bestätigt, zumal meine Vermutung, daß er nur aus Versehen hineingekommen ist und legt ein lyrisches Flugblatt bei „Waldpastelle“, sechs Gedichte von Paul Zech. Verlag A. R. Meyer, Wilmersdorf. – Der Verlag Heinrich F. S. Bachmaier, dessen Inhaber, Herr Bachmair, ein junger Lyriker, sich mir jüngst im Café Bauer vorstellte, sendet eine Reihe seiner Publikationen, und von Hugo Sonnenschein kam ein Buch „Genosse Einsam von Unterwegs“, Adria-Verlag, Wien und Leipzig. Lektüre in Mengen –
München, Dienstag, d. 27. August 1912.
Das war ein seltsamer Nachmittag gestern – voll von Ungewöhnlichem. Um 3 Uhr sollte ich bei Michalsky sein wegen der Redaktionskonferenz für „Zib“ (Zeit im Bild). Preetorius hatte inzwischen dorthin Nachricht gegeben, daß er erst um ½ 5 dort sein könne, und man entließ mich für die 1½ Stunden. Ich wollte in ein nahes Café gehn, traf aber auf der Straße die beiden Beutler-Jungs, die mir berichteten, ihre Mutter sei wieder zuhause. So ging ich inzwischen zur Beutlerin, mit der ich mich gut unterhielt. Um ½ 5 war ich wieder in der Germaniastrasse und traf dort die Herren Dr. Preetorius, Renner, Schwarzer und Freksa. Michalsky selbst telefonierte mit Frankfurt a/Main und wir warteten 1½ Stunden auf ihn. Die Besprechung fand also nicht statt. Ich erteilte mir nur selbst mit Zustimmung der übrigen den Auftrag, eine kleine Zeichnungsserie zu textieren (ich hoffe auf 20 Mk). Wir gingen also alle auseinander, ich mit Freksa in dessen Wohnung (er wohnt von Margarete, seiner Ehefrau, ein paar Häuser getrennt). Er kredenzte mir Schnaps und guten Wein, von dem wir zwei Flaschen tranken, und inzwischen berichtete ich ihm von der Sketch-Sache. Er gab mir da folgende Ratschläge: ich solle eine reguläre Sherlock-Holmes Geschichte da hineinarbeiten, in der Form, daß ich einen Hochstapler auftreten lasse, der sich als Sherlok Holmes ausgibt. So lassen sich sehr komische und schreckhafte Wirkungen erzielen, auf die es ja bei einem Sketch ankomme. Er schrieb selbst sofort per Schreibmaschine eine Postkarte an den Verleger Lutz in Stuttgart, um ihn zu veranlassen, die ganze Sherlock-Holmes Bibliothek an mich zu senden. – Was das Honorar anlangt, so riet mir Freksa, 1000 Mark für jeden Monat zu verlangen, in dem die beiden das Zeug spielen. Das könnte also ein noch viel glänzenderes Geschäft geben, als ich in den kühnsten Träumen annahm. – Gegen 8 Uhr gingen wir zu Michalsky zurück, den wir mit seiner Frau, Renner und dem Verleger Müller beim Abendbrot antrafen. Wir wurden noch mit Pflaumenkuchen, Bier und Sekt traktiert und gingen dann selbst Abendbrot essen – in die Schwabinger Brauerei. Dort saßen an einem Tisch außer diversen Unbekannten Professor Graf Du Moulin und Direktor Schaumberger. Ich frozzelte mich sehr lustig mit dem alldeutschen Grafen herum. Dann kam Margarete Beutler, die leider später hysterisch wurde, sodaß unser Aufbruch sehr plötzlich war. Auf der Straße gab sie mir zum Adjö nicht mal die Hand. Warum weiß ich nicht. In der Torggelstube schlief ich ein, ging aber dann noch ins Bauer, wo ich mit Vorel Schach spielte. Um 2 Uhr schwer bezecht heim.
Heute kam ein Brief von Onkel Leopold, der mir sehr zu schaffen macht. Er will zum 2. September nach Lübeck fahren und hofft, bei Papa irgendwas durchzusetzen. Er rechnet mir vor, daß die Einrichtung höchstens 8000 Mk kosten werde, daß also, wenn 50000 Mk im ganzen für uns ausgesetzt sind, an Zinsen bei 5 % 2100 Mk blieben. Er nimmt an (ob er dafür positive Gründe hat?), daß Papa seinen Zuschuß auf 1900 Mk erhöhen werde, sodaß wir also 4000 Mk sicher hätten – und er meint, daß ich doch wohl auch noch ein paar Tausend Mark verdiene. Ja, wenn aus dem Sketch-Geschäft was wird! – Eine sehr sehr peinliche Nachricht enthält der Brief obendrein noch. Von den 175 Mk, die ich bisher monatlich kriege, sind 100 von Papa (also eigentlich von meinem Geld), 50 von meinen Geschwistern und 25 aus der Erbschaft von Tante Jeannette. Diese Erbschaft, schreibt Onkel, ist jetzt alle, und ich könne die 25 Mk höchstens noch ein oder zweimal kriegen. Das ist sehr fatal, und wenn nun nicht schleunigst neue Hilfsschleusen sich auftun, weiß ich nicht, wie ich fernerhin dies Leben in der Pension fortsetzen und dabei Johannes regelmäßig unterstützen soll. Ich hab arge Angst. – Jetzt wurde ich durch den Besuch des jungen Graf gestört, dem ich seine recht dilettantischen Dichtversuche kritisieren und Steinebach zum Verlag empfehlen sollte. Ich habe mir[ihm] so gut es geht geholfen. Nun muß ich Briefe schreiben: an Onkel Leopold, an Johannes und an Jenny.
München, d. 29. August 1912
Ich bin in größter Sorge und Aufregung wegen Jenny. Seit Sonntag habe ich kein Wort von ihr erhalten. Dabei hat sie mir jüngst, als sie schon einmal solange nicht schrieb, fest versprochen, daß es nicht wieder vorkommen solle und sich damals mit ihrer russischen Reise entschuldigt. Von der wollte sie aber Montag schon wieder zurück sein. So habe ich garkeine Erklärung für ihr Verhalten und fürchte das Ärgste. – Vielleicht hat sie sich einen Interims-Liebhaber zugelegt und geniert sich deswegen. Als ob sie mir das nicht ehrlich zugeben könnte! Ich werde doch von einem so prachtvoll sinnlichen Geschöpf keine trauernde Witwenschaft und monatelange Sexual-Abstinenz verlangen. – Ich habe ihr heute geschrieben und meine ganze Angst und Aufregung in einen kurzen Brief gelegt, der hoffentlich seine Wirkung tun wird. Zu all den Zweifeln und Skrupeln wegen der Entwicklung unsrer Angelegenheit auch noch schlechte Behandlung von Jenny selbst!
Meine Interims-Ehe soll nun heute nacht beginnen. Gestern war Grete, die Ferienbraut, zum Mittagessen bei mir. Heute erwarte ich sie zum Abendbrot, und dann gehn wir, wenn wie sie hofft, ihr monatliches Opfer gebracht sein wird, zur Begrüßungsfeierlichkeit ins Bett. Ich freue mich drauf. Ein voller Monat Keuschheit ist lange Zeit.
Aus den letzten Tagen ist folgendes zu vermerken: Vorgestern Abendbrot bei Roda Roda, nachdem ich vorher mit Meyrink über die Verleumdung gesprochen hatte, in die wir beide als Opfer verwickelt wurden, und die mich die Mitarbeiterschaft beim Dreimaskenverlag gekostet hat. Meyrink hatte selbstverständlich von vornherein an die Sache nicht geglaubt und war sehr nett. – Später Torggelstube mit Roda Rodas. Roda erzählte einen Traum, den er gehabt hat und der für den Witzbold sehr charakteristisch ist. Ihm hat geträumt, er sei dabei abgefaßt wurde[worden], wie er mit einem Billet für den dritten Kreuzzug am zweiten teilnahm. – Echt Roda Roda.
Gestern brachte ich dem „Simpl“ wieder mal sechs Texte und erhielt à conto darauf von Dr. Bleich 20 Mk. Morgens hatte ich schon Besuch von Mariechen gehabt, die sich von mir unter die Röcke greifen ließ und mir meine letzte Mark abnahm. Später mußte ich Grete Krüger noch mit 3 Mk und Mariechen mit weiteren 2 Mk aushelfen, sodaß jetzt nur noch die Hälfte vom gestrigen Reichtum übrig ist. Das Teuerste im Leben ist der Dalles der Freunde. – Abends holte ich Margarete Beutler zum Kleinen Theater ab, wo momentan ein Einakter-Cabaret, das sich „Hölle“ nennt, Vorstellungen giebt – Attraktion: Mary Irber. Sie hat doch immer noch sehr viel Charme, wenn sie auch garnichts kann. Sie sah reizend aus, und es war amüsant, wie in allen ihren Vorträgen der Hauptcoup der war, daß sie ihre wundervollen Beine zeigte, bis hoch übers Knie. Ich ging dann noch mit der Beutlerin ins Bauer. Ausführliche Gespräche über Christian Morgenstern, den ich leider nicht persönlich kenne. Dann brachte ich sie zu Fuß bis zur Helmtrudenstrasse, wo Freksa wohnt. Wir überfielen ihn nachts um ½ 1 Uhr, und ich kriegte dort noch Kaffee und guten Wein. Dann begleitete ich die Beutler zur nächsten Straße, Gundelindenstrasse und lieferte sie vor der eignen Wohnung ab. Um ½ 3 Uhr war ich glücklich, übermüdet, zuhause.
Ein Brief von Jane aus Genf. Ihre Mutter wolle sie nach Paris mitnehmen, sie wolle aber nach München zurück. Ich soll im Namen einer Dame, die ich nicht kenne, einen Brief in deutscher Sprache an sie schreiben, daß sie am 17. September hier erwartet werde. Soll geschehn.
Jetzt gehe ich in den Hofgarten, und dann endlich an die Arbeit für die neue „Kain“-Nummer. Bis jetzt steht mir noch nicht mal der Inhalt des Septemberheftes fest. Ich bin schon ein Oberfaultier.
München, Freitag, d. 30. August 1912.
Endlich ein Brief von Jenny – ohne viel Inhalt aber voll so viel herzlicher Liebe, daß ich doch recht beglückt bin. Mich regt auf, daß ihr Vater noch keine Antwort von den Auskunftsbüros hat. Ich verstehe das nicht. Die Leute brauchen doch sonst keine 4 Wochen dazu, um einen Bescheid zu geben, noch dazu in einer Sache, die vollkommen klar und ohne Komplikationen ist. Ich wittere Intrigen. Vielleicht hat der Alte längst Nachricht und will die Geschichte nur in die Länge ziehn. Entzückt scheint man ja in Eydtkuhnen von unserem Heiratsplan nicht zu sein.
Grete Krüger versetzte mich gestern und enttäuschte mich dadurch sehr. Das Talent haben ausnahmslos alle Weiber, Männer ohne ein Wort der Entschuldigung aufsitzen zu lassen. Ob die Beziehung damit vereitelt ist, ob sie vielleicht einen andern gefunden hat, oder ob nur ihr Zustand noch keine sexuellen Abenteuer erlaubt, weiß ich nicht.
Heut vormittag saß ich, wie immer, im Café Bauer und las Zeitungen, nachdem ich vorher vom Simplizissimus einen Korb erhalten hatte. Ich wartete auf die zwei reizenden Blondinen, die jeden Tag dort frühstücken, und mit denen ich schon auf Grüßfuß stehe in der Hoffnung, sie demnächst ansprechen zu können. Ich glaube, es sind französische Schweizerinnen. Während ich sie noch erwartete, kam plötzlich eine Dame auf mich zu, die ich im ersten Moment für meine verstorbene Tante Tina hielt und sagte: „Erich?“ – Sie sei Lotti aus Smyrna. Dann kam auch ihr Mann, Maulwurf, und mein Vetter Walter. Zu dem mußte ich mitgehn, Mittag essen. Bei dieser Gelegenheit lernte ich seine hochschwangere Frau kennen, eine kleine Blondine, aber ein wenig menubbelhaft. Martin war ebenfalls da. Er machte eine sehr gute Bemerkung über meinen Vater: „Für Onkel gibt es nur offizielle Werte.“ Das ist eine ausgezeichnete Charakteristik.
Ich will jetzt schließen und gleich noch einmal an Jenny schreiben, um ihr den unangenehmen Eindruck des letzten Briefes möglichst schnell zu verwischen.
München, Sonnabend, d. 31. August 1912.
In großen Aengsten sehe ich diesmal dem Monatswechsel entgegen. Von den 175 Mk, die ich – diesmal noch – kriege, bekommt die Pension etwa 150 (mit Trinkgeldern etc). Hoffentlich nicht mehr. Steinebach muß ich 6 Mk für eingezogene Abonnements abliefern. Johannes, dem ich telegrafisch schicken muß, kostet 45 Mk. Meine Schuhe sind zu besohlen: ich rechne 4 Mk. 10 Mk muß ich Schmidt-Bertuch geben für Brentanos „Godwi“, das ich für Jenny gekauft habe. 2 Mk 50 für Briefporto, und gewiß werden sich noch sonst allerlei Ausgaben als notwendig erweisen. Rechne ich nun, daß ich wirklich vom „Simpl“ und von „Zib“ noch zusammen 40 Mk kriege, so fange ich doch den Monat wieder mit einem Defizit von etwa 20 Mk an und habe garnichts für die laufenden Spesen des Tages. Es ist entsetzlich und bei der grauenvollen Hartnäckigkeit des Vaters so garkeine Hoffnung, daß dies Leben bald anders werde.
Ich habe in den letzten Tagen zwar hier allerlei notiert, doch aber wieder sehr viel vergessen. Manches davon will ich nachholen. Da war zunächst vom letzten Starnberger Aufenthalt ein Nachmittags-Ausflug nach Tutzing zu erwähnen. Ich aß mit Gotthelf und Lottchen im Simon Mittag und versuchte dann, Liesel Steinrück zu besuchen. Die schlief und Steinrück war in die Umgebung gefahren, um zu malen. Gestern bekam ich nun eine sehr liebenswürdige Karte von Liesel, in der sie ihr Bedauern ausspricht, daß wir uns nicht sahen, und daß ich nicht zum Abendessen blieb und mich herzlich auffordert, demnächst nach vorheriger Anmeldung wiederzukommen. Das will ich gewiß tun.
Ferner ist die Sache mit dem Justizrat Pailler (den ich übrigens aus der Torggelstube kenne) weitergegangen. Ich schrieb ihm einen energischen Brief, erinnerte ihn darin an unsere persönliche Bekanntschaft, gegen die er anscheinend keine Bedenken hatte und stelle ihm anheim, mir für den „Kain“ einen Entschuldigungsbrief zu schreiben, andernfalls ich ihn verklagen müßte. Er schickte mir den Brief zurück mit der Erwiderung, ich sei „von sykophantischer und denunziatorischer Seite“ falsch informiert worden. Er hätte garkeinen Anlaß, gegen mich aggressiv zu werden und habe nur, da es sich um die Unterhaltswürdigkeit des Herrn Gilardone handelte, auf seine Beteiligung an der Bahnhofsgeschichte „Mühsam u. Gen.“ hingewiesen, um festzustellen, wann er denn eigentlich arbeite. Mein Name sei nur leise dem gegnerischen Anwalt gegenüber genannt worden. – Natürlich ist seine Darstellung unwahr. Da er aber kneift und jetzt den Tatbestand nicht mehr wahrhaben will, werde ich die Sache wohl auf sich beruhen lassen.
Gestern war Gruppenzusammenkunft. 5 Personen. Der Wirt des „Gambrinus“ hat uns das Lokal gesperrt. Das ist, glaube ich, das vierte Mal, daß uns das passiert. Jetzt geht die Sucherei wieder los. Ob wir ihm nicht genug Bier konsumiert haben, oder ob – was leider das Wahrscheinlichere ist – die Syndikalisten gegen uns intrigiert haben, darüber hat er sich nicht geäußert. Ich bin sehr erbittert, auch über Morax, der wieder ganz lässig geworden ist und sich an lauter verbummelte Leute, Klein, Jung etc. anschließt. Das letzte Mal war ich nicht dort – Morax schon seit 3 Wochen nicht mehr. Da hat, wie mir berichtet wurde, Jung, Mariechens Ehemann, die Gelegenheit ergriffen, über mich herzuziehen. Feige und gemein. Sobald ich ihn treffe, soll er meine Meinung hören. Nähme mir doch jemand die Mühe ab, die ich mir all die Jahre mit dem unbrauchbaren Material gebe. Oder kritisierten mich die Herrschaften wenigstens, wenn ich dabei bin! Welche traurige Autoritätsanerkennung, hinter dem Rücken eines Menschen seine Superiorität anzugreifen!
Nachher Torggelstube. Ich saß zuerst allein. Dann kamen die Maler Spiegel und Erich Wilke, die bald wieder gingen. Nachher die Lorm und Feldhammer. Dann Rosa Valetti, Else Ward, die ich von der Vallé-Zeit her im Intimen Theater kennen lernte. Beide sind in der Bonbonnière engagiert – und Anny Rosar. Sie gingen sehr bald wieder, da sie in der Odeon-Bar eine Verabredung hatten. Ich spielte dann noch mit Feldhammer im Orlando Billard und kam gegen 2 Uhr heim.
Von Grete Krüger sehe und höre ich nichts. Sehr merkwürdig. Ob sie einen andern gefunden hat? Ob ein höheres Schicksal es verhindern will, daß ich Jenny untreu werde? Heut oder morgen muß es sich wohl entscheiden, ob Gretes Unsichtbarkeit Zufall ist oder Absicht. – Eventuell müssen die Blondinen aus dem Café Bauer aushelfen.
München, Sonntag, d. 1. September 1912.
Die Ereignisse drängen sich, daß ich nicht weiß, wo anfangen. Also chronologisch:
Gestern abend ist Uli und Seewald wieder angekommen. Lotte, Strich, das Ehepaar Kutscha und ich waren am Bahnhof. Uli sieht prachtvoll gebräunt aus, und riesig wohl. Gleich nach dem Begrüßungskuß berichtete sie mir etwas sehr Aufregendes: Im Laufe des September wird Friedl nach München kommen, da ihr in Neulustheim die Wohnung gekündigt ist und sie die Möbel verstauen muß. Ich bin ungeheuer gespannt, sie wiederzusehn. Mir stiegs ganz heiß zum Herzen, als ich hörte, sie werde kommen. – Wir gingen dann alle zusammen zu Farina und ich von dort um ½ 11 in die Torggelstube, da ich Grete Krüger Bescheid hinterlassen hatte, sie möchte dort anrufen (was nicht geschah). In der Torggelstube fand ich eine riesige Festgesellschaft vor, das ganze Schauspielhaus, ferner Halbe mit Damen und Sohn, und noch alle möglichen Leute. Gustel Waldau wurde gefeiert, der gestern zum letzten Mal im Schauspielhaus aufgetreten ist. Siegfried Raabe und Friedrich Karl Peppler hielten lustige Reden und überreichten Geschenke. Es wurde mordsmäßig getrunken und die Polizei hatte Konzession bis 4 Uhr erteilt. Eine sehr komische Vorstellungsszene. Ich bin am Pissoir und schlage das Wasser ab. Neben mir giebt sich ein Herr derselben Tätigkeit hin. Er: „Gestatten Sie, daß ich mich bei dieser Gelegenheit vorstelle. Ich bin Seeger.“ Ich: „Das sehe ich.“ – Es war der Schauspieler Seeger vom Schauspielhaus. – Ich freundete mich sehr mit Ludwig Heller an. Schließlich fuhren wir im Auto los: Randolf und die Swoboda, Heller und ich. In der Giselastrasse, wo Randolfs wohnen, erlitt das Auto eine Panne. Wir sagten dem Ehepaar adjö und ich begleitete den schwerbetrunkenen Heller heim. Er torkelte die Stiegen hinauf und kam dann mit seinem Terrier wieder herunter, da der gute Mensch in seinem schweren Suff immer blos davon geredet hatte, daß der arme Hund eingesperrt sei und noch auf die Straße müsse. Er begleitete mich dann noch die Friedrichstrasse hinauf und ich ihn wieder hinunter. Unterwegs bot er mir Geld an. Ich wollte aber seinen Rausch nicht ausnutzen und kündigte ihm an, daß ich im Lauf der Woche kommen würde, ihn um 100 Mk anzupumpen. Er wird sie sicher geben – ein lieber Kerl.
Heut kam nun ein Brief von Jenny, der endlich Greifbares enthält. Die Auskunft über mich ist eingelaufen und lautet sehr günstig. Jenny meint, sie werde bis zu den Feiertagen, die am 12. September beginnen, sicher die Zustimmung ihrer Eltern erwirkt haben und stellt als wahrscheinlich in Aussicht, daß wir uns in etwa 3 Wochen in Berlin sehn werden. – Im übrigen ist der Brief wieder unsagbar zärtlich und liebevoll. Wie schön ist es, von einem geliebten Weibe geliebt zu werden. Ich glaube, wir werden sehr glücklich miteinander sein.
Von Robert Lutz, Stuttgart sind 9 Bände Sherlock-Holmes-Romane eingetroffen. So wird mein Sketch wohl bald greifbare Gestalt annehmen. Ich sehe momentan sehr optimistisch in die Zukunft. Nur vor den nächsten Tagen graust mir. Leider hat Onkel Leopold das Geld trotz meiner dringenden Bitte wieder nicht rechtzeitig geschickt. So muß der arme Johannes wieder warten und womöglich deshalb noch wieder einen Monat länger in Villepreux bleiben. Es ist ärgerlich.
München, Montag, d. 2. September 1912.
Eben – es ist 8 Uhr abends – kommt ein Telegramm: „Noch nicht erledigt. Stimmung jedoch günstiger. Jenny.“ Das geliebte Kind scheint also heute sehr ernsthafte Auseinandersetzungen mit dem Vater gehabt zu haben. Es würde wirklich längst Zeit, daß die Eydtkuhner Herrschaften sich endlich dreinschickten. Es ist entsetzlich, wie unsre Nerven von dritten Personen strapaziert werden. Aber nun denke ich doch, wird bald der Tag kommen, wo mir meine Verlobung offiziell mitgeteilt wird. –
Gestern starb der Generalintendant des Hoftheaters Freiherr v. Speidel. Seine Krankheit war in der Torggelstube längst allgemeines besorgtes Gesprächsthema, und mich hat kaum je die Krankheit eines Fremden so aufgeregt wie diese. Sein Tod läßt für den Münchner Theaterbetrieb das Schlimmste befürchten. Bei der klerikalen Strömung, die jetzt in Bayern vorherrscht, kommt womöglich irgend ein stramm kirchlich gesinnter Mann an den Posten – und dann ists aus. Dann erleben wir den Fortgang Steinrücks, und es wird eine grenzenlose Öde im Repertoire sein. Die Ritscher wird dann natürlich nicht engagiert, und wir werden die Berndl und die Swoboda noch häufiger genießen als jetzt schon. Daß es anders kommen wird, daß ein tüchtiger modern gestimmter Mensch Speidels Nachfolge antritt – die Hoffnung ist leider sehr schwach. – Heut traf ich Queri. Er meinte, er habe gehört, ich wolle General-Intendant werden. Prinz Ludwig habe mich vorgeschlagen. Ich erwiderte: „Pst! Sagen Sie es noch nicht weiter. Ich bin mit dem Prinzen Ludwig über den Vorschuß noch nicht einig.“
Gestern war ich in der Bonbonnière. Neues Programm mit Else Ward und Rosa Valetti, denen ich versprochen hatte, zur Premiere zu kommen. Dressler verschaffte mir Eingang. Erst saß ich zwischen Fremden unten, bis mich Reinhold Körting zu seiner Frau in den Rang hinaufholte. Eine reizende Person – diese Lene Körting. Ich sagte ihr meine Meinung. Sie hört sowas gern. Man lud mich zu Wein und Sekt ein. – Das Programm war langweilig: am besten Dressler und die Rolffs, die erst seit kurzem nach ihrem schweren Automobilunfall wieder singt. Die Ward ist in ihrer Wurschtigkeit sehr gut, ihre Vorträge (von einem gewissen Harry Waldau) aber ganz minderwertig. Ebenso hatte die Valetti sich zwei Sketche ausgesucht, die zum Speien waren. Sie selbst spielte ausgezeichnet. Nachher noch mit Körtings Torggelstube, wo wir die Lorm und Feldhammer trafen. Später mit Körting Billard im Orlando. Ich wurde von dem Ehepaar per Auto vor meiner Haustür abgesetzt.
Heut kam das Geld von Berlin. Außerdem holte ich mir vom „Simpl.“ für ein Gedicht und einen Witz 30 Mk. So konnte ich mal wieder alles bezahlen. Mein Restkapital beträgt 14 Mk. Gott helfe weiter!
München, Mittwoch, d. 4. September 1912.
Ich mag nicht viel einschreiben heut. Ich habe den ganzen Nachmittag gearbeitet und sehne mich nach Unterhaltung. Jenny schreibt sehr wenig. Seit dem Telegramm ist keine Zeile von ihr eingetroffen. Ich habe ihr geschrieben und ernstliche Vorhaltungen gemacht. Es ist sonderbar, wie lieb mir das Mädchen ist, wie ich es vermisse.
Es passierte nichts Belangvolles in diesen Tagen. In der Torggelstube liegt jetzt jeden Abend die wirklich reizende Else Ward auf, die einen unglaublich schnodderigen Ton hat, der aber nie gemein wird. – Gestern war ich im Lustspielhaus, und sah „Wie man einen Mann gewinnt“, ein Reißer von irgendeinem Amerikaner. Die Valetti ausgezeichnet. Else Kündinger, die im ersten Akt eine Stumme Rolle hatte, war, solange sie nicht sprechen mußte, ausgezeichnet, nachher dilettantisch. Alva übel, Schnell leidlich, sehr gut eine neue Entdeckung, eine komische Alte namens Lore Arand, reichlich verschmiert, aber sehr originell. Ich ging während des dritten Aktes fort, da mich die Valetti im Auto mitnehmen wollte.
Was mit Grete Krüger ist, ist mir ganz unklar. Sie vertröstet mich von einem Tag auf den andern. Dagegen interessieren mich meine unbekannten blonden Freundinnen aus dem Café Bauer von Tag zu Tag mehr. Ganz reizende Geschöpfchen. Mariechen möchte sich gern wieder anbinden. Ich versage aber. Sie behauptet, jetzt endgiltig mit ihren Mann fertig zu sein. Er sei schon abgereist. Ich zweifle.
Morax sprach ich gestern und heute. Er will mich in die Umgebung von Ingolstadt verschleppen. Dort arbeiten tausende von Kunden beim Hopfenzupfen. Ich soll ihnen einen Vortrag halten. Könnte mich schon reizen. Wenn mir Morax nur nicht so schrecklich auf die Nerven ginge. Ich kämpfe dagegen an, aber ich empfinde immer ein leichtes Grauen, wenn er heranschleicht. Er hat neuerdings etwas an sich, was ich nicht definieren kann – etwas Modriges, Leichenhaftes.
München, Freitag, d. 6. September 1912.
Dieser Sommer ist fürchterlich. Es gießt unaufhörlich, ist kalt wie im Februar und alle Welt niest, schnaubt und spuckt. Recht die Stimmung, die mich auch innerlich beherrscht. Ich komme nicht weiter mit meinen Arbeiten und komme nicht heraus aus der Geldnot. Von Jenny bis jetzt nur Vertröstungen, die letzte allerdings schon verheißender als die früheren. Sie meint, spätestens morgen (Sonnabend) abend werde sich unser Schicksal entscheiden. Sie wage nur immer nicht, ihrem Vater die strikte Antwort abzuverlangen, da sie immer noch ein Nein fürchte. Doch tut sie alles, um eine Pression auf die Eltern auszuüben. So benimmt sie sich vollkommen als Braut, spricht in Gegenwart des Vaters und ihrer Tante über unsre Verlobung und weiht alle Freundinnen ein, die ihr Glück wünschen. Besonders, schreibt sie, sei ihre Freundin Gertrud Haase, die Tochter des Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, entzückt von ihrer Wahl. Wir werden sie in Berlin besuchen. Es wäre lustig, wenn ich auf diese Weise mit dem Rechtsanwalt Haase in persönliche Berührung käme, der übrigens, soviel ich weiß, ein Studienfreund meines Bruders Hans ist.
Natürlich regt mich die Jenny-Angelegenheit ununterbrochen so auf, daß die übrigen Tatsachen ganz an Bedeutung verlieren. Ich bin allabendlich im Torggelhaus, und freue mich, wenn nette Frauen da sind. Die Valetti ist ein Prachtmensch, mit dem ich mich vom ersten Tag unserer Bekanntschaft an duze. Else Ward, sehr hübsch, ist auch ein lieber Kerl. Neulich wars sehr komisch. Sie hatte eine Vierzimmerwohnung gemietet, in der sie ganz alleine schlafen muß. Nun suchte sie krampfhaft nach einem „harmlosen Beischläfer“. Ich war ihr leider nicht harmlos genug. – Leider wird die Torggelstube seit einigen Tagen entstellt durch den neuen Korrespondenten des „Berliner Tageblatts“, einen Dr. Friedental, ein widerlicher Geselle, der fortwährend redet, alles am besten weiß und den Horizont eines Konfektionärs hat. Man muß ihn abschaffen. Ich werde es wohl übernehmen müssen. Meine Nerven halten den Kerl nicht aus.
Gestern war im Hoftheater die Festvorstellung des Vereins Volksfestspiele: Calderons „Standhafter Prinz“ von Georg Fuchs. Eine Frechheit. Das Calderonsche Stück ist reizend. Ich las es in diesen Tagen in der Reclam-Ausgabe. Was Fuchs daraus gemacht ist[hat], ist widerwärtig. Die Handlung verdünnt und zusammengestrichen; dafür unheimlich breite ölige larmoyante Frömmeleien. Es war ekelhaft. Der Kerl will Hoftheater-Intendant werden und sich mit dieser Kriecherei vor dem Katholizismus bei den Pfaffen lieb Kind machen. Die Ablehnung war allgemein. Ich saß neben M. G. Conrad, der mich darauf aufmerksam machte, daß den Gesängen und Bibelsprüchen lutherische Texte untergelegt waren. Ich soll für Jacobsohn über die Aufführung schreiben. Fuchs kann sich freuen. – In der Torggelstube flüchtete ich später mit der Valetti und der Ward vor Herrn Dr. Friedenthal ins Orlando. Der Architekt Lutz mit Frl. Wilfried von der „Bonbonnière“ schloß sich uns an. Als wir von dort nach Hause wollten, sah ich grade Wedekind ins Torggelhaus gehn und ging noch einmal hinein. Er war mit seiner Frau und Kutscher. Auch Steinrück und Strauß waren inzwischen gekommen. Steinrück, der mit der Inszenierung des Fuchsschen Drecks sehr Tüchtiges geleistet hatte, mußte sich viel Spott gefallen lassen, schimpfte aber feste mit. – Ich freute mich, daß der junge Herr Alten, der zum ersten Mal in einer tragenden Rolle (als Fernando) herausgestellt wurde, trotz der Undankbarkeit der Aufgabe sehr achtbar spielte. Alles andre war mäßig und darunter. Durchaus zweite Garnitur des Hoftheaters.
Gestern sprach ich Frau Minnie Kornfeld, die ich auf ihre Anmeldung hin ins Café Bauer bestellt hatte. Sie machte mir starke Avancen, und ich lud sie zu heut Mittag zum Essen ein. Sie versetzte mich aber, und ich wurde von Mariechen gezwungen, sie mitzunehmen. Gottseidank merkte sie nicht, daß ich begütert war, denn ich habe mir heute früh 30 Mk vom „Simpl.“ geholt. – Sie geht mir allmählich schrecklich auf die Nerven. Ich konnte sie heute nicht mal küssen: – Grete Krüger will nun Montag zu mir kommen. Sie versicherte mir heute, daß ihre beständige Verhinderung bisher reiner Zufall war, und daß sie sich sehr auf unsre erste Nacht freue.
Johannes ist endlich von Villepreux fort, da ich ihm diesmal sein Geld einigermaßen rechtzeitig telegrafisch schicken konnte. Er teilt mir seine neue Adresse mit: Champigny par Strechy, Seine et Oise.
München, Sonntag, d. 8. September 1912.
Die Dinge gehn langsam aber stetig vorwärts. Onkel Leopold berichtet über seinen Lübecker Besuch. Papa läge sehr daran, daß meine Heirat zustande käme. Er wolle die 1200 Mk jährlich weiterhin geben, Onkel hofft aber, mehr zu erzielen. Papa hat vorgeschlagen, er wolle mit Herrn Brünn in Berlin zusammenkommen, oder aber Julius solle in seinem Auftrag nach Eydtkuhnen fahren oder der Vater Brünn soll an den Vater Mühsam oder an Julius oder an Onkel Leopold oder der Eydtkuhner Rabbiner an den Lübecker Rabbiner schreiben. Kurzum: man ist in Lübeck sehr für die Sache engagiert. Onkels Brief enthält ferner die immerhin fürs erste tröstliche Mitteilung, daß er mir die 25 Mk monatlich noch bis zum 1. Dezember als Zinsvergütung schicken werde. – Vielleicht habe ichs ja vom 1. Januar ab überhaupt nicht mehr nötig – dank Jennys Liebe. – Eine Postkarte von Papa, der sich für meinen Geburtstagsglückwunsch bedankt und mir zu Rauschhaschanoh das Gelingen meiner Ehepläne wünscht. Er ermahnt mich, den Brünn-Eltern zu Neujahr zu gratulieren. Soll geschehen. Zugleich teilt er mit, daß Dr. Wichmann, unser alter Hausarzt, gestorben ist. Ich sah ihn zuletzt, als ich vor vier Jahren zu Papas 70tem Geburtstag in Lübeck war. Er ist 62 Jahre alt geworden. Mit diesem Doktor Wichmann stirbt wieder ein ganzes Stück meiner Kindheit weg. Meine erste Liebe war seine Tochter Edith. Sie war drei Jahre alt, ich fünf; wir spielten täglich zusammen und küßten uns inbrünstig. Da starb sie an Diphteritis. Ich erinnere mich mit großer Klarheit, wie ich damals zum ersten Mal über das Phänomen des Todes nachdachte. Ich sehe den Kinderleichenwagen noch, der die Kleine fortbrachte. – Karl, der Älteste, war mein erster, langjähriger Freund. Er verriet mich damals in der „Volksboten“-Geschichte, und hielt damit die Knabentreue schlecht, die ich ihm stets gehalten hatte. Wie oft habe ich von Papa Wichmann eins mit der Reitpeitsche bekommen. Die Keile gingen in eins weg mit der Erziehung seiner eignen Kinder. Merkwürdig: der Mann, dachte ich, müßte sehr alt werden, die lebendigste Kraft, ein sehr sympathischer Mensch.
Heute in aller Frühe kam von Jenny ein Brieftelegramm. Sie sei beunruhigt, da sie drei Tage ohne Nachricht sei. In der Sache sei nichts gefördert, aber ihre Mutter, die im Bade ist, habe brieflich ein Rendez-vous in Berlin vorgeschlagen, das in spätestens drei Wochen stattfinden werde. Das wäre ja in der Tat erfreulich. Spreche ich erst mal mit den Eltern, dann kommt die Sache auch zu Stande. Soviel traue ich mir schon zu.
Im äußeren Erleben wenig Belangvolles. Gestern nach der Torggelstube mit Heinrich Mann, Oppenheimer, Hertzog, Kauffmann, v. Jacobi im Odeon-Casino. Bekanntschaft mit einer schwitzenden Kurtisane aus Dessau, die den ganzen Tisch mit ihrem ordinären Gebaren höchlich amüsierte. Herr Kauffmann poussierte sie, leckte ihr die Schweißtropfen vom Schweinsgesicht und ging dann wahrscheinlich mit ihr schlafen. Um ½ 5 kam ich nach Hause, wurde um ¾ 7 durch Jennys Telegramm geweckt und stand 9 Uhr auf, da um ½ 10 Uhr Frau Minnie Kornfeld kommen wollte. Sie hatte mich gestern im Café Bauer angerufen, und war dorthingekommen. Unsre Gespräche hatten leicht erotische Anklänge. Wäre sie zu mir gekommen, dann wäre es ganz sicher nicht bei einem harmlosen Besuch geblieben. Statt ihrer kam aber – leider erst, nachdem ich schon eine Stunde außer Bettes war, eine entschuldigende Postkarte, sie müsse zum Arzt. – Morgen will nun also Grete Krüger kommen. Ich zweifle freilich, da sie gestern, wie mir Frau Dr. Eigner sagte, influenzakrank im Bett lag. Ich soll scheinbar durch höhere Mächte zur Treue gegen Jenny gezwungen werden. – Mein Bedürfnis, von Zeit zu Zeit mal ein paar Mädchenlippen zu küssen, befriedigte ich heute im Bavariabad, wo ich das Badefräulein, das das Wasser in die Wanne ließ, hernahm und ganz gehörig abknutschte. Ich fürchte nur, jetzt werde ich bei jedem Besuch der Anstalt dazu verpflichtet sein.
München, Dienstag, d. 10. September 1912.
Meine Arbeiten bleiben ganz zurück. Ich soll Herrn Schlömp Balladen schreiben, für die er Geld gäbe. Aber ich komme nicht dazu. Ich soll endlich den Sketch für Pallenberg schreiben. Er steckt noch in den ersten Worten. Ich soll mich um „Zib“ kümmern. Da ich da gestern Michalski nicht antraf, wird das wohl auch wieder gute Wege haben. Ich soll den Kain-Kalender für 1913 schreiben. Ich weiß noch kein Wort, das drinstehn wird. Ich soll hunderterlei und nichts geschieht. Dabei weiß ich, sobald ich Jenny bei mir haben werde, wird alles geschehn. Ich werde Geld haben. Es wird wundervoll sein. Aber jetzt habe ich schon wieder seit dem Telegramm kein Wort von ihr, und ihr Schweigen macht mich nervöser als alles andre. Ich habe ihr das oft genug geschrieben. Es hilft nichts. Sie schreibt viel seltener als ich und beschwert sich über meine Faulheit. Es ist ein Kreuz.
Frau Minnie Kornfeld ist Sonntag abend endlich abgereist, von mir in den Zug gesetzt. Sie hatte mich nachmittags vergeblich aufgesucht. Hätte sie mich getroffen, dann wäre zweifellos etwas passiert. Denn am Bahnhof ließ sie sich – erst im Wartesaal, dann noch im Zug willig den Mund küssen.
Sonnabend hörte ich bei Roda Roda die Vorlesung des neuen Stückes von ihm und Meyrink. Anwesend waren außer den Autoren und mir Basil, Waldau, Oppenheimer und der unmögliche Dr. Friedenthal. Ich kam leider erst zum zweiten Akt des Stückes, das „die Uhr“ heißt und eine abenteuerliche Mischung von Schaurigkeit und Posse darstellt. Man spürt Meyrink aus der ganzen Anlage heraus. Schon daß die Handlung auf einem Turm spielt, sieht ihm ähnlich. Die Arbeit ist zum mindesten enorm interessant und hat ausgezeichnete Stellen. Es wird entweder ein katastrophaler Durchfall werden oder ein Kassenerfolg.
Gestern abend mit Mann, Hertzog und Roda ins Torggelhaus. Von da mit Roda zum Krokodil. Von da mit Körting und Schmitz ins Plendl Billard spielen und schließlich mit den beiden in den „Serenissimus“ zu einem Schnaps. – Heut hoffe ich, mit dem Sketch vorwärts zu kommen. Die Kasse ist wieder fast leer.
München, Donnerstag, d. 12. September 1912.
Noch immer liegt das Manuskript für Pallenberg-Massary kaum begonnen da, und über mir hämmert ein Mensch den ganzen Tag und läßt mich zu keinem ruhigen Gedanken kommen. Das Monstrum von Stubenmädchen, nach dem ich geklingelt habe, kommt nicht, und ich bin sehr nervös. – Die Verlobungsangelegenheit wird nun freilich wahrscheinlich bald ins Reine kommen. Gestern und heute kamen Briefe von Jenny voll lieber Zärtlichkeit. Sie meint, am 23. September werden wir uns in Berlin treffen und macht süße Andeutungen über ein Alleinsein, auf das sie hoffe. Es wäre wohl tröstlich, wenn nun alles wird wie sie schreibt, dann würden wir Ende November schon verheiratet sein. Gott gebs. Lange halte ich das Leben in diesen elenden Plüschmöbeln nicht mehr aus.
Gestern mittag wurde ich im Caféhause durch den plötzlichen Eintritt Otto Gross’ aufs höchste überrascht. Ich kann nicht sagen, daß das Wiedersehn reine Freude in mir auslöste, aber Freude war sicher auch dabei. Er kommt von Florenz und will hier bleiben. Er kam mir verhältnismäßig in guter Verfassung vor, doch geht das ja bei ihm so auf und ab, daß ich ihn erst häufiger sehn müßte, um urteilen zu können. Die Sofie-Geschichte geht ihm immer noch fortwährend nach. Er psychologisiert ununterbrochen darüber, wie der Selbstmord hätte vermieden werden können und ich hielt ihm vor, daß er sich daraus Vorwürfe mache, daß er nachträglich gefundene Erkenntnisse nicht damals schon als Richtlinien beobachtet habe. Er kam dann mit zu mir und gab mir einen Brief zu lesen, den er Frieda schicken will – voll Haß gegen Frick, der ihn ganz beherrscht. Noch mehr vielleicht erfüllt ihn die Wut gegen Landauer – immer noch wegen der alten Geschichten. Über Johannes sprach er keineswegs freundlich. Ich gab ihm deutlich zu verstehn, daß mir sein hartes Aburteilen über Menschen, die es gut mit ihm meinen, mißfällt. Dann brachte ich das Gespräch auf seine Erotik. Natürlich ist hier der Haken. Er hatte seit Sofies Tod keine Frau und sucht eine, die er aber bei seiner krankhaften Art und bei dem gänzlichen Mangel an Sorgfalt in seinem Aeußeren schwer finden wird. Entsetzlich: dieser Schwerenöter von früher!
Abends war ich mit Mann und Hertzog im Ratskeller Abendbrot essen. Dann Torggelstube, wo an allen Tischen gespielt wurde. Um ½ 2 ging ich heim, wobei ich seit langem wieder ein Gedicht zustande brachte: „Ich weiß von allem Leid, fühl alle Scham –.“
Heut mittag sprach ich die ältere von meinen blonden Caféhausfreundinnen an, wobei ich erfuhr, daß die (hübschere) Schwester – Leonie, genannt Lo – nach Nizza abgereist sei, und sie – Jane – ihr in einigen Tagen folgen werde. Sie kam dann mit zu mir, aber ich war enttäuscht, da sie mir ein wenig beschränkt vorkommt. Zum Schluß konnte ich sie – unter Überwindung schwachen Widerstands – gehörig küssen.
Emmy ist von Flensburg zurück. Sie sieht wieder frisch und mobil aus. In der Telefonzelle des Caféhauses forderte sie mich energisch auf: „Faß mich lieber an!“ Mir scheint, ich werde wohl auf Emmy zurückkommen müssen, um Jenny untreu zu werden. Aber sie versichert glaubhaft, daß sie gesund ist. Also warum nicht.
München, Freitag, d. 13. September 1912.
Endlich kommt die Verlobungs-Angelegenheit in Zug. Ich habe Jenny die Adresse meines Vaters schicken müssen, da der ihrige an ihn schreiben will, und Montag über 8 Tage will sie in Berlin sein, und dort soll, wenn ich sie recht verstehe, die Verlobung offiziell gemacht werden. Ich werde recht froh sein, wenn all das äußerliche Getue überstanden ist, und ich Jenny endlich in ein eignes Heim einführen kann. Die Schwierigkeit sehe ich nur noch im Geldpunkt, doch beruhigt mich die Geliebte immer wieder darüber: ihre Eltern werden ihr bestimmt soviel geben, daß wir so auskömmlich wie sie selbst davon werden leben können. – Die Briefe Jennys sind unendlich lieb, wenn auch ein wenig Höhere-Töchterhaft, was mich doch einigermaßen überrascht, da sie mir im persönlichen Umgang garnichts davon zu haben schien. Aber vermutlich färbt das Eydtkuhner Milieu auf sie ab, und ich will sie ja auch zum persönlichen Umgang heiraten und nicht zur ewigen Briefstellerin. Dabei ist sie sehr jung und ich denke, unter meiner Obhut und Anleitung wird sich viel unendlich Wertvolles und Gutes aus ihr herausholen lassen.
Die letzten Tage waren von Otto Gross so stark okkupiert, daß ich sehr fürchten mußte, durch die Anstrengung der Unterhaltungen mit ihm werde jede Energie zur Arbeit in mir gelähmt werden. Das habe ich ihm heute gesagt. Darauf schrieb er mir diese Woche ins Notizbuch: „Das ist aus der Psychologie, die ich nicht reden darf: Erich, im Ernst, Du mußt zur Zeit mit irgend etwas beschäftigt und darauf aus sein, was wesentlich nicht gut sein kann. Ich bin dir diesmal – es ist wirklich nicht Selbstüberschätzung, daß ich so spreche, ins Haus gefallen wie der Eckart – und wurde z. Th. als solcher behandelt – – Was du heute gesagt hast, heißt: Du mußt immer, bevor du deine jetzige Beschäftigung wieder aufnehmen kannst, verdrängen, auf was dich das Zusammensein mit mir gebracht hat. Das aber ist dein wirkliches Sein, nur das; nicht von mir, sondern von dir selber wird dir mit mir zusammen die tiefere Wirklichkeit wieder bewußter – und die mußt du verdrängen, bevor etc. etc. und daraus – etc –“ Gross’ Unterstellungen haben in der Tat etwas, was stark ergreift und suggeriert. Was mich aber in Wahrheit so anstrengt und ablenkt, ist die fortwährende Einstellung auf die ungewohnte Terminologie eines Monomanen. Ich muß mich fortwährend in Ausdrücken wie Komplex, Masochismus, Sadismus, Analyse, Verdrängung etc. zurechtfinden, und alle in neuen Bedeutungen angewandt. Und ferner ist mir schrecklich der Haß, den Otto gegen einige Leute hat, und den er fortgesetzt betont und in Beziehung setzt zum Tode Sofie Benz’. In Bezug auf Landauer versuchte er, mich vor die Alternative zu stellen: Er oder Er! Ich lehnte solche Alternative schroff ab, woraus sich die psychologische Erklärung ergab: ich habe das Bedürfnis, mich von aller Welt foppen zu lassen. Über Johannes fiel er mit wahrhaft leidenschaftlichem Haß her und stellte die groteske Behauptung auf, er lasse sich in allem von finanziellen Erwägungen leiten. – Ungeschickt ist er ja nicht, wenn er einen Menschen von andern abbringen will. Als er mich an Johannes hysterische Intriguen erinnerte, mit denen er mich von Frieda trennte, kochte etwas in mir auf. Er hat damals – natürlich in der Analyse – Gross Dinge von mir erzählt, die haarsträubend sind. Die Indiskretionen, die ich gegen Frieda ihm gegenüber beging, und die bestimmt nicht respektlos waren, hat er völlig entstellt wiedergegeben, als ob ich Frieda beschmutzt hätte. Damals hatte Gross solche Wut auf mich, daß er mich durchaus umbringen wollte. Ich wußte das selbst und ging – es war Ende 1908 – stets mit dem Gefühl herum, daß mir nach dem Leben getrachtet wurde. Schließlich stellte ich Gross eines Tages darauf und erklärte ihm, ich könne mich gegen Mord nicht schützen, man solle aber so anständig sein, ihn nicht meuchlings zu begehn. Damals war aber der Mordplan schon aufgegeben. Gestern sprachen wir das alles durch, und er bat mir viel ab. – Aber Frieda hat es doch den Knax gegeben. Das kann von uns beiden nie wieder gut gemacht werden. – Ich habe heute an Frieda geschrieben, ihr über Gross berichtet und ihr auch meinen Heiratsplan mitgeteilt. Wenn nur ihr Herkommen nicht mit meiner Berliner Reise kollidiert. Mir wä[re] die ganze Freude mit Jenny verdorben. – Gestern gab mir Gross 20 Mk, er drängte sie mir direkt auf, und da ich vorgestern von „Zib“ ebenfalls 20 erhalten habe, bin ich wieder für ein paar Tage gerettet. Wenn nun nur noch die Sketchsache gelingt! Daß ich in Berlin würdig auftreten kann.
München, Montag, d. 16. September 1912
In den letzten Tagen ist wieder soviel durcheinandergegangen, daß ich wohl nur ganz weniges von dem, was mich inzwischen tangiert hat, festhalten kann – und ans Chronologische kann ich mich da schlecht halten. – Gestern traf von Jenny ein Brief ein, der mir viel zu schaffen machte. Sie habe mit ihrem Vater großen Krach gehabt, und ihm angekündigt, sie werde schon Dienstag abend nach Berlin fahren. Ihre Mutter hingegen habe ihr vom Bade aus sehr nett geschrieben, sodaß sie jetzt von ihr die Hilfe erwartet. Zu der Reise solle ich ihr 100 Mk sofort schicken. Ich war entsetzt: 100 Mk! und im Moment absenden. Natürlich ging das nicht und ich schrieb ihr so ratlos und verzweifelt, daß ich heut abend ein Beruhigungs-Brieftelegramm nachsenden werde. Vielleicht kann ich ihr darin schon mitteilen, daß sie morgen die 100 Mk geschickt bekommt, sicher kann ich ihr ankündigen, daß ich Mittwoch früh abreise. Das Geld dazu habe ich. Ich komme eben von „Zeit im Bild“ wo ich 30 Mk bekam (20 Honorar, 10 Vorschuß) und von Heller, den ich um 100 Mk anpumpte. Heut abend aber hoffe ich über bedeutend mehr Geld zu verfügen. Gestern traf ich nämlich im Torggelhause Pallenberg und die Massary, denen ich einfach erklärte, der Vorentwurf zu dem Sketch sei fertig. Wir verabredeten also, ich solle ihn ihnen heut mittag in der Odeon-Bar, wo wir zusammen essen würden, vorlesen. Nun kam aber eine so große Menge Menschen hin (die Valetti, die Rosar, die Niklas, Muhr, Rößler, Edmund Edel und Strauß[)], daß dort an eine Vorlesung nicht zu denken war, umsoweniger, als alle andern gleich zur Valetti aufbrachen zum Pokern. So soll ich heut abend um 7 Uhr im Theatercafé in der Ausstellung sein. Ich habe Pallenberg schon angekündigt, daß er sich Geld einstecken müsse – 100 weitere Mark hoffe ich ganz bestimmt zu kriegen, selbst wenn den beiden mein Entwurf nicht gefallen sollte. Sind sie sehr entzückt bitte ich mir 300 aus. Jedenfalls werde ich Jenny einiges schicken können, was ich im „Godwi“ verstauen werde. – Von Johannes und Iza kam heute ein Brief. Der arme Freund hat Rheumatismus. Iza beklagt sich, daß ich nicht schreibe. Ist vorgestern geschehn. – Gross habe ich mir ein wenig vom Hals geschafft. Er strengte mich zusehr an. – Und übermorgen reise ich – und sehe, wenn nicht alle Zeichen trügen, meine Jenny wieder.
Betrogen habe ich sie bis jetzt garnicht richtig. Gestern wars allerdings wieder nahe daran – und zwar war die häßliche Melanie Spielmann zum Essen bei mir, die mich aus – der Teufel weiß was für Gründen erotisch reizt. Ich hatte mich schon entblößt und sie war mit ihrer – auffallend schönen – Hand schon da, wohin verliebte Mädchen zu greifen pflegen, da gestand sie mir, daß sie unwohl sei. Das Schicksal ist gegen mich wie mir scheint und für Jenny, also doch für mich. Morgen nacht ist sie bei mir angemeldet. Doch kann ich sie schlecht brauchen, da ich Mittwoch sehr früh aufstehn muß. Ich hoffe, binnen spätestens 14 Tagen offiziell verlobt zu sein.
München, Donnerstag, d. 19. September 1912.
Immer spärlicher werden hier die Eintragungen, und auch heut will ich mich auf ein paar Daten beschränken, die im Zusammenhang mit der Entwicklung meines Lebensplanes mit Jenny stehn. Zwei gleichlautende Telegramme, die Dienstag früh ankamen und deren Duplizität nicht aufgeklärt ist, enthielten die Weisung von Jenny, ich solle nicht nach Berlin fahren. Depeschenbrief folge. Der kam gestern früh und besagte, die Berliner Reise habe keinen Zweck mehr. Sobald Jennys Mutter zurück sei, werde der Vater nach Lübeck schreiben an Papa und Julius Joël nach Eydtkuhnen einladen. Es sei alles so gut wie erledigt und Ende November werde auch der „offizielle Teil“ vorbei sein. Ich sandte das Telegramm an Papa um ihn auf Herrn von Brünns Brief vorzubereiten. Ich habe nun doch beschlossen, nach Berlin zu fahren, und zwar morgen früh. Erstens will ich mit Onkel Leopold reden, – ich hoffe doch, daß man mir über die Verlobungszeit ein entsprechendes Auftreten vor den Schwiegereltern ermöglicht, dann auch, weil es mir vor allen Angepumpten peinlich wäre, wenn der Grund, mit dem ich das Geld herauslockte, plötzlich gegenstandslos wäre. Von Rössler bekam ich noch am Bahnhof, als er in den Zug stieg, 50 Mk. Er fuhr mit Pallenberg (der mir auch nur 50 Mk gab), der Massary und Edel. Der Abschied war sehr lustig. Pallenberg und Rößler hielten sehr komische Ansprachen ans Publikum. – Und von Strich hatte ich auch noch 10 Mk bekommen. Ferner von Muhr 10 Mk für eine gewonnene Wette (die unsterbliche Partie Anderssens).
Erotisch bin ich Jenny merkwürdig treu. Vorgestern wollte Melanie Spielmann für die Nacht zu mir kommen. Ich kam deswegen nicht nach Hause. Heute wollte Emmy mich vom Café Bauer (das seit heut Café Glasl heißt) zu mir abholen. Ich versetzte sie und las meine Zeitungen im Café Parade. Der unterbewußte Wille zur Treue ist bewußt geworden.
Jena, Freitag, d. 27. September 1912
Auf der Rückreise von Berlin. Gottseidank. Diese Stadt ist doch entsetzlich, und ich werde noch lange an ihr laborieren, da sie mir ein recht peinliches Andenken in Gestalt eines argen Katarrhs auf den Weg mitgegeben hat. Den chronologischen Bericht über die letzte Woche spare ich mir. Nur soviel, daß die Reise im Grunde recht überflüssig war. Jenny kam nicht. Ihre Mutter wollte mich treffen, war aber, da der Eydtkuhner Vater intriguiert hatte, nicht aufzutreiben. Die ganze Sache ist etwas rätselhaft. Das Schönste in dieser Woche war ein Telefongespräch mit Jenny, die mich letzten Sonntag in Waidmannslust anrief. Die liebe Stimme! Aber ich mußte mich sehr beherrschen, da Onkel, Tante und Arthur neugierig und interessiert im Zimmer saßen und zuhörten. Jenny schrieb mir täglich – unendlich zärtliche süße Briefe. – Mit Onkel besprach ich die Affaire. Er meint, er werde, wenn er Frau Brünn sprechen könne, sicher einen Modus finden, nach dem wir werden leben können. Jenny hofft bestimmt, die Hochzeit auf vor Weihnachten prophezeien zu können. Ich wollte, sie behielte recht. Ich sehne mich nach dem Mädchen. Ihren Freund Dr. Karl Landauer lernte ich kennen. Ich rief ihn auf Jennys Veranlassung in der Edelschen Klinik an, wo er Assistent ist. Mittwoch traf ich ihn außerdem bei Hans und Minna. Ein feiner, aber langweiliger Mensch. Ein sehr anständiger Kerl, aber eingebildet. Ich schrieb an Jenny: Ein Bürger mit künstlich erweitertem Horizont. Sie ist begeistert von der Charakteristik. – Bei Hans und Minna war ich zweimal. Hans ist ein Mensch, mit dem ich innerlich garkeine Beziehungen habe. Banausisch bis oben hinaus.
München, Sonntag, d. 29. September 1912.
Es giebt viel nachzutragen. Ich will versuchen, das Wesentliche andeutungsweise festzuhalten, nachdem ich in Jena durch die Auftragung des Diners im Hotel zum Schwarzen Bären, nach dem ich gleich abreisen mußte, gestört wurde.
Zunächst muß ich vermerken, daß meine sexuelle Treue gegen Jenny doch nicht bis zur Berliner Reise standgehalten hat. Am Tage, ehe ich fuhr, rief mich im Café Bauer plötzlich eine Dame an, in der ich zu meinem Erstaunen Kätchen Brauer erkannte. Sie beruhigte mich zunächst durch die Mitteilung, daß sie schon Wohnung genommen habe und kam dann mit mir. Das Mädel ist 35 Jahre alt. Dem Gesicht sieht man das mitunter ein wenig an, der Körper ist aber noch ganz geschmeidig, jung und straff, und ihre hingebende Wildheit unvermindert. – In Berlin besuchte ich am Freitag meiner Ankunft Hans und Minna, in der Hoffnung, dort Abendbrot zu schinden. Hans trat mir im Korridor mit Zilynder und Gehrock entgegen, im Begriff zur Synagoge zu gehn. Es war Jaum-Kippur-Anfang, also Fasttag, und ich flüchtete zu Aschinger. – Ich war täglich im Café des Westens und sprach viele alte Freunde: Rudolf Johannes Schmied, Ali Hubert, Spela, Felix Hollaender, Peter Baum, John Henry Mackay, den ich in der Untergrundbahn traf, Adolf Paul, Gustav Landauer, der meinetwegen ins Café Monopol kam und noch viele. – In Waidmannslust war ich zweimal, und wäre nicht das erquickende Telefongespräch mit Eydtkuhnen gewesen, dann wäre mir die ganze Reise recht überflüssig vorgekommen. Was ich mit Onkel Leopold besprach, hätte ich gradesogut schriftlich erledigen können, und daß er mir vorrechnete, daß wir zum Leben selbst in bescheidenen Verhältnissen mindestens 7000 Mk brauchten, stimmte mich wenig mutvoll.
In der Zeitung las ich während des Berliner Aufenthalts, daß sich Dr. John Andreas, mein bewährter Zahnarzt, irgendwo im Wartesaal eines Provinz-Bahnhofs erschossen habe. Er war ein sympathischer und sehr tüchtiger Mann, den ich demnächst wieder besuchen wollte. Jetzt werde ich mir einen andern Zahnarzt suchen müssen. – Von einem Todesfall, der mich viel näher angeht, erfuhr ich in Berlin: Dort ist vor etwa einer Woche Kaschka Prawitz im Kindbett gestorben, meine alte liebe Kaschka, meine unglückliche Liebe Nr. 2. (Krater). – Als es im Café der Oberkellner Hahn erzählte, kam es mir vor wie ein Witz. Ich war garnicht im mindesten erschüttert, und als er berichtete, sie sei verheiratet gewesen, war ich roh genug, zu antworten: „Verheiratet? Kaschka? Dann freut mich der ganze Tod nicht mehr.“ – Erst als ich spät nachts heimging, fiel mir alles ein, mir ging auf, wieviel gute Erinnerung da gestorben ist, und daß mir Kaschka einmal viel gewesen ist. Schon wie ich sie kennen lernte! Das war wohl in dem bewegten Jahr 1903. Sie war mit dem Cabaret-Dichter Eisenstadt befreundet, und daher kannte sie mich vom Sehen. Einmal sprach sie mich unter den Linden an, sie wolle mich malen. Da sie so hübsch war, die graziöse kleine Polin, sagte ich gleich Ja, und sie bestellte mich zum andern Tag zu Herrmann Stuck aufs Atelier. So lernte ich den kennen, ohne Ahnung, daß er mit meinem Bruder intim befreundet ist. Das Portrait wurde scheußlich, aber es hing, als ich sie vor 2 – 3 Jahren mal besuchte, immer noch in Kaschkas Atelier. Auf meinen Rat ging sie dann ans Cabaret und hatte im langen Babykleid mit offnen Haaren viel Erfolg. Als ich nach längerer Abwesenheit mal wieder nach Berlin in ein Cabaret kam, trat sie grade auf. Sie unterbrach ihren Vortrag, als sie mich kommen sah und stürzte mir vom Podium herunter in die Arme und küßte mich coram publico ab. – Kaschka ist die einzige Frau, derentwegen ich mich mal rasieren ließ. Nachts bei Colster (1903) saß ich neben ihr, sehr betrunken, war furchtbar verliebt und verlangte stürmisch nach einem Kuß von ihr. Einen bärtigen Mann küsse sie nicht. Es mochte wohl schon 5 Uhr morgens sein, ich torkelte fort, fand einen offenen Barbierladen und ließ mir den Vollbart abnehmen. Als ich zu Colster zurückkam, waren alle längst heimgegangen. – – Kaschka war mit einem Dr. Soltau verheiratet, ich vermute mit dem Juristen aus Lübeck, Radbruchs und Curt Siegfrieds Freund. Sie wird mir lieb bleiben.
Donnerstag abend wollte ich nach München zurückkehren. Als ich nachmittags mein Täschchen zum Anhalter Bahnhof brachte, fiel mir ein, daß es ganz gescheit sei, statt die Nacht durchzureisen, irgendwo unterwegs in einem Hotel zu bleiben. Ich fuhr daher in plötzlicher Eingebung mit einem langsamen Zug gleich los nach Jena, wo ich abends eintraf, noch in ein Conzert-Café ging und bald schlafen ging. Am Freitag vormittag sah ich mir die Stadt und besonders das Volkshaus von Abbé an. Ein wundervoller Bau. Ich nahm im Volksbad ein sehr wohltuendes Bad und fuhr mittags nach München.
Hier erfuhr ich sehr ärgerliche Geschichten. Frau Jung hat böse Schweinereien gemacht. Sie hat ihren Mann der Polizei als Anarchisten denunziert und dabei ausgeplaudert, was sie neulich in der Gruppe Tat gehört hat, u. a., daß ich an Frieda Gross einen Brief geschrieben habe, um sie zu veranlassen, dem armen Genossen D. zu helfen, der sich bei Carl Gräser kreuzunglücklich fühlt. Mariechen wollte mich heute im wieder eröffneten Café Stefanie begrüßen. Ich stellte sie kurz zur Rede, erklärte ihr, daß ich mit Polizeidenunzianten nichts zu tun haben wolle und drehte ihr den Rücken. So habe ich wieder eine Feindin.
Gestern war Premiere von Birinskis „Narrentanz“ im Schauspielhaus. Ein Stück, das sehr flott einsetzt, theatralisch auch sehr geschickt gebaut ist, aber zum Schluß völlig abfällt. Ich will im „Kain“ ausgiebig drüber schreiben. Morgen muß die Arbeit beginnen. Es wird wieder hohe Zeit.
Heut habe ich an die Gräfin geschrieben. Von ihr war ein Brief gekommen, in dem sie mich lebhaft zu Jenny beglückwünscht (Sie weiß es durch Frieda) und sehr geängstet berichtet, Rechenberg wolle sich von ihr scheiden lassen, da er glaube, sie sei hier in München noch einmal verheiratet. Er wolle herfahren und werde sie schrecklich kompromittieren. Ich möchte ihn, wenn er sich bei mir zeigt, mit allen Mitteln von München fortbringen. – Ferner schrieb ich an die Fastenrath-Stiftung eine neue Bewerbung um den Preis. Vielleicht hat der Himmel mit Halbes Hilfe ein Einsehen. – Was noch? Ach so: Gestern mittag aß das Puma bei mir. Nachher kam – vor Rößler heimlich – Consul zu mir, den ich wie in alten Tagen abküßte. Später mit Lotte, Uli und Kutschas auf der Oktoberwiese.
Noch eine kleine Episode mit Uli: Vorgestern traf ich sie im Torggelhaus. Als ich ihr beim Adjö die Hand küßte, nahm sie heimlich meine Hand und küßte sie ebenfalls. Dann sah sie mich unendlich lieb an und sagte: „Mühsam, du bist ja ein Dummkopf. Aber ich hab dich doch sehr gern.“ – Ich war sehr glücklich. Uli ist immer noch das märchenhafte Wesen von ehedem.
München, Dienstag, d. 1. Oktober 1912.
Nun habe ich (¼ nach 9 Uhr abends) den Leitartikel für die Oktober-Nummer des „Kain“ fertiggeschrieben, und will doch nicht fortgehn, ehe ich nicht hier ein paar Daten festgehalten habe.
Mit meiner Treue gegen Jenny ist es nichts – wenn ich die bürgerlichen Begriffe anlegen will (Denn meine Liebe zu ihr ist so gut und treu, daß die kleinen Zwischenabenteuer ihr garnicht das Geringste anhaben können).
In Berlin hielt mich eines Nachts eine Hure fest, und nachdem ich mich lange gewehrt hatte, verschleppte sie mich doch in ihre Wohnung, wo ich wenigstens erreichte, daß ich um den Koitus herumkam und auf für mich ungefährlichere Weise zu meiner Befriedigung kam. 4 Mk hat das arme Mädel nur für ihre Tätigkeit erhalten. Ein ganz nettes, offenbar seelengutes Geschöpf. – Und vorgestern gab es wieder eine Entgleisung. Emmy kam aus dem Café mit mir heim – und natürlich gleich ins Bett. Gestern ist sie nach Kattowitz abgefahren, wo sie für einen Monat an ein Cabaret engagiert ist. – Sie machte mir die überraschende Mitteilung, daß sie rasend in Otto Gross verliebt sei, ich möge ihm das sagen und ihn veranlassen, ihr nach Kattowitz nachzureisen. Er kennt sie noch garnicht. Ich sprach mit ihm, und natürlich ist er glücklich. Nachreisen wird er wohl nicht, aber wenn Emmy wieder hier ist, wird vielleicht für beide aus dieser Verbindung Gutes entstehn können.
Gestern wollte ich zum Krokodil gehn, traf aber unterwegs Steinrück, der mich ins Hoftheaterrestaurant verschleppte. Die Theaterleute sind in Aufregung, da an Speidels Stelle ihr neuer Chef ernannt ist: Ein Baron Clemens von und zu Franckenstein, bis jetzt Kapellmeister an der Berliner Königlichen Oper, aber noch ein ganz unbeschriebenes Notenblatt. – Steinrück erzählte mir, ein Redakteur des „Berliner Börsen-Couriers“ sei bei ihm gewesen. Man wolle Gumppenberg nicht länger als Münchner Theaterreferenten und bat Steinrück um Rat. Er empfahl dringend mich. Das scheiterte leider daran, daß Landauer in Berlin für das Blatt über Theater schreibt, und sie zwei Anarchisten nicht wollten. Ich habe schon ein gigantisches Pech. – Nachher kamen Heinrich Mann und Wilh. Herzog.
Die Gräfin ist in München. Ich sprach sie flüchtig im Hofgarten. Morgen früh besucht sie mich. Ich bin sehr gespannt, da sie mir ankündigt, sie habe eine Reihe Bestellungen von Frieda Gross auszurichten.
München, Freitag, d. 4. Oktober 1912.
Zunächst ein Theaterabend. Am Mittwoch im Residenztheater: „Mutterliebe“ und „Wetterleuchten“ – beides von Strindberg. Das erste ein Akt, das zweite drei Szenen. Beider Inhalt: das Weib in seiner Tücke. In „Mutterliebe“ geht ein junges Mädchen am Egoismus seiner Mutter kaput, in „Wetterleuchten“ zerstört ein Weib ihr eignes Andenken in der Erinnerung ihres geschiednen Mannes. Beide Stücke von Kilian inszeniert. In „Mutterliebe“ machte sich das peinlich fühlbar. Es wurde miserabel gespielt. Am schlechtesten war die Swoboda als die Mutter. Alma Lind, die neuerdings am Hoftheater engagiert ist, ebenfalls recht dürftig. Selbst die Hohorst als Tochter gefiel mir weniger als sonst, obwohl sie starke Momente hatte. Am besten und eindringlichsten war die Conrad-Ramlo als alte intrigante Theater-Garderobiere. – „Wetterleuchten“ war nominell auch von Kilian inszeniert. Da aber die Hauptrolle von Steinrück gespielt wurde, ging sein Geist durch die ganze Aufführung. Er war wieder einzig, von einer fast erschreckenden Natürlichkeit. Auch Basil als sein Bruder, der Consul, war recht anständig. Etwas schwächer Schröder als Konditor Stark, aber ausgezeichnet Frau v. Hagen als Gerda, die geschiedne Frau. Im ganzen eine sehr würdige Aufführung, die das Beklemmende der Strindbergschen Atmosphäre stark herausbrachte. –
Nachher Kegelbahn, und dann „Simplizissimus“. – Gestern war die Gräfin bei mir. Sie sieht trotz ihrer 40 Jahre sehr gut aus, besonders hat das Haar jetzt eine schöne natürliche blühend-blonde Farbe. Sie berichtete viel von Frieda, die sehr nett von mir spreche und mich sehr grüßen lasse. Sie freue sich aufrichtig über meinen Heiratsplan. Sie werde jetzt nicht nach München kommen, da sie keinesfalls mit Otto zusammentreffen möchte, von dem sie Schweinereien gegen Frick fürchte. Frieda sei infolge der Fricksachen mit den Nerven sehr auf dem Hund. Frick ist, nach Ansicht der Gräfin, für Frieda ein großer Segen und es wäre entsetzlich, wenn er zu langer Freiheitstrafe verurteilt würde. – Von ihrer eignen Ehe mit Rechenberg berichtete sie ebenfalls ausführlich. R. wolle sich von ihr scheiden lassen, und habe in seiner Wut gegen sie seinem Vater die ganze Schiebung mit der Eheschließung verraten. Jetzt fürchtet die Gräfin vom Schwiegervater Testamentsänderungen zu ihren Ungunsten. Die Arme! Womöglich kommt sie jetzt um den ganzen Ertrag der Heirat. Sie lachte sehr bei dem Gedanken, daß sie Rechenberg nun womöglich wirklich „um seiner selbst willen“ geheiratet hätte. Montag will sie wieder zu mir kommen.
Nachmittags war ich bei „Zib“, wo ich Freksa traf. Mit dem zur Weinstube Michels, wo ich ein paar Witze machen mußte. Wir unterhielten uns recht gut und erwägen, ob wir nicht zusammen ein Lustspiel schreiben sollen. Nachher lud mich Rößler in einen Kientopp ein. Der Consul, Oppenheimer und Eyssler waren auch mit. Dann Abendbrot auf Rösslers Kosten in der Odeonbar, wohin Gustel Waldau kam, der morgen zum ersten Mal im Residenztheater auftritt. – Ich ging dann noch, von Rößler und dem Consul im Auto dorthin gebracht, ins Torggelhaus, wo ich Birinski traf. Lange Dispute über seinen „Narrentanz“. Er schickte mir heute das Buch, nebst dem „Moloch“, damit ich nicht nur die Aufführung kenne, wenn ich darüber schreibe. – Heut vormittag gab ich beim „Simpl“ einige Witze ab. Ich traf dort Thoma, Geheeb und Thomas Theodor Heine, den ich – merkwürdigerweise – zum ersten Mal persönlich kennen lernte. Ich möchte gern an Stelle von Karl Borromäus Heinrich in die Redaktion eintreten. Dann wären alle Schwierigkeiten, unsre Ehe zu finanzieren behoben. Ich fürchte aber, es wird nichts draus werden. Mir traut kein Mensch fleißige Ausdauer zu.
Von Jenny kommen fast täglich liebe zärtliche Briefe. Die starke Liebe zu mir, die sich darin ausdrückt, festigen auch meine Gefühle immer mehr. Wir werden sehr glücklich sein.
München, Sonnabend, d. 5. Oktober 1912
Von Jenny habe ich gestern und heute keinen Brief gehabt. Ich bin sehr geängstet deswegen. Denn morgen wird ihre Mutter wahrscheinlich bei Onkel Leopold in Berlin sein, und ich habe inzwischen garnichts erfahren. Ich habe ihr etwas erregt geschrieben. Hoffentlich liegt ihrem Schweigen nichts Ernsthaftes zugrunde.
Eben sende ich einen Brief an Geheeb ab (der mir heute früh für ein Gedicht („Die Asphaltfläche schimmert feucht“) und zwei Witze 40 Mk auszahlte. Ein Trost). In diesem Brief bewerbe ich mich offiziell um die durch Heinrichs Ausscheiden freiwerdende Redakteurstelle. Ich bin enorm gespannt auf die Antwort. Es wäre herrlich, wenn ich den Posten kriegte. Endlich Sicherheit, und endlich die Möglichkeit, Jenny zu erhalten ohne degradierende Bedingungen. Aber ich zweifle.
München, Sonntag, d. 6. Oktober 1912
in der Nacht zum Montag, ½ 4 Uhr.
Ich bin zu aufgeregt, um gleich schlafen gehn zu können. Von Jenny kam auch heute keine Nachricht und auf ein Telegramm, das ich mittags an sie absandte keine Antwort. Ich bin völlig fassungslos, da ich mir ihr Verhalten absolut nicht erklären kann. Ihr letzter Brief, der am Donnerstag früh ankam, schloß „Deine Dich über alles liebende Jenny“ – und nun plötzlich scheint’s, als ob alles aus sei. Ich mache mir die abenteuerlichsten Gedanken über die Gründe ihres Schweigens. Manchmal denke ich, sie ist tot: aber das hätten mir ihre Eltern gewiß mitgeteilt, wenigstens wären doch meine täglichen Briefe zurückgekommen. Oder ihr wird meine Korrespondenz unterschlagen (im letzten Brief beklagte sie sich – wie mir scheint grundlos über meine Schreibsäumigkeit), und sie hält mich für verhaftet, tot oder ihrer überdrüssig. Vielleicht ist sie mit ihrer Mutter in Berlin und will mich durch die Mitteilung überraschen, daß alles erledigt ist: aber ich wage nicht mehr, mir die Sache günstig auszulegen. Vielleicht – das hat vielleicht am meisten Wahrscheinlichkeit – mag sie mich nicht mehr. Ich habe ihr vor einigen Tagen die von Muhr aufgenommene Photographie geschickt. Vielleicht sagt ihr meine Physiognomie plötzlich Böses. Aber daß sie mich so ganz im Unsicheren ließe, kann ich mir auch dann nicht denken. Jenny, liebste beste Jenny! Ich habe Dich so lieb! so sehr lieb! Den Gedanken, Dich für immer zu halten und bei mir zu haben – oh Du, – ich kann ihn nicht einfach wieder aufgeben und vergessen! Warum muß denn mir alles so übel ausgehn? Warum darf ich nie an Glück und Frieden denken? – Ich bin sehr trostlos, sehr unglücklich und verzweifelt. Nun will ich zu Bett gehn und zu schlafen versuchen. Und wenn morgen wieder keine Nachricht kommt, dann glaube ich, fahre ich einfach nach Eydtkuhnen ab oder begehe eine andre große Dummheit. Noch hoffe ich ja – so fürchterlich kann es das Schicksal nicht mit mir vorhaben, daß ich Jenny wieder verlieren sollte.
München, Dienstag, d. 8. Oktober 1912.
Das Jenny-Rätsel hat sich ganz harmlos aufgelöst. Gestern früh kam ein Brieftelegramm mit beruhigendem Inhalt, und dann ein Brief: es waren mal wieder zwei jüdische Feiertage gewesen, an denen sie nicht schreiben durfte, am Freitag hatte sie dann einen Brief abgeschickt, den der Sonntagsbriefträger nicht mehr kriegte, und so war ich zu meiner heillosen Angst gekommen.
Nun bleiben noch eine Reihe von Dingen zu erzählen. Ein Theaterabend im Residenztheater: „Der Seeräuber“, ein Lustspiel von Ludwig Fulda, bemerkenswert nur dadurch, daß Gustl Waldau darin zum ersten Mal im neuen Engagement auftrat. Das Stück ist ein langweiliger alberner Kitsch in schlechten vierfüßigen Trochäen, harmlos zum Erbrechen. Regisseur: Basil. Waldau war sehr lustig, aber ich habe auch ihn schon besser gesehn, im übrigen die Darstellung ganz unaufregend. Nur die Neuhof, die mir bisher in allen Rollen als Sentimentale entsetzlich war, stand als lebenslustiges junges Weib hoch über ihrem sonstigen Niveau. Das war mir eine große Überraschung.
Sonnabend machte ich eine bemerkenswerte Bekanntschaft. Ich traf nachmittags im Café Bauer v. Maaßen, der dort mit seinem Freund Dr. Ebstein saß, einem Arzt, den ich schon Mittwoch auf der Kegelbahn kennen gelernt hatte, und der starke bibliophile Interessen hat. Er hatte ein kleines Mädel bei sich, Anny geheißen, recht nett, mit funkelnden sinnlichen Augen, doch aber sonst ganz harmlos. Ich beachtete sie zunächst wenig. Abends, verabredeten wir, wollen wir alle zusammen essen und gingen dann auch zu Farina. Ich kam Anny vis-à-vis zu sitzen und fing an, mit ihr zu fußeln. Sie reagierte derart, wie ich es selten erlebt habe. Schließlich richtete ich es ein, daß ich neben ihr sitzen konnte und schob ihr meine Karte mit Adresse, Telefonnummer und Zeitbestimmung für den Anruf zu. Sie legte ihr Bein zwischen meine, und wäre nicht Ebstein aufmerksam und eifersüchtig geworden, dann wäre es mir gewiß nicht schwer gefallen, die durch Alkohol und gereizte Sinnlichkeit gradezu schön gewordene Kleine mit mir heimzunehmen. Ich erreichte noch, daß sie mir ihre Adresse, nach der ich sie unter harmlosem Vorwand fragte, mitteilte. In dem Lokal saß allein ein Herr, den Maaßen und Ebstein herüberholten: Horst Stobbe, Inhaber des Antiquariats Schönhut, des Hauptlieferanten für die Bibliophilen. Das ist derselbe, dem Glasberg seinerzeit die Briefe verkauft hat, und ich sprach ihn darauf an. Wir kamen auf meine Züricher Körbe zu sprechen, und beschlossen, daß er sie von der Firma Kuoni auslösen soll. Darin ist ein wahrer Schatz von handschriftlichen Köstlichkeiten vergraben. Ich bin sehr gespannt. – Ferner will er den Rest der „Wüste“ übernehmen – und zwar nur 10 Stück, die er mit dem Seltenheitspreis von 5 Mk mit 33⅓ % Provision in Kommission nehmen wird. Außerdem werde ich noch 8 Exemplare mit Widmungen versehn und ihm pro Stück mit 5 Mk verkaufen. Die Widmungen fingiere ich natürlich. – Wir gerieten mächtig ins Zechen, gingen noch ins Torggelhaus, ins Café Orlando, und als das geschlossen wurde, zu Maaßen in die Wohnung. Ebstein hatte das Mädel inzwischen völlig mit Beschlag belegt, da er sichtlich eifersüchtig wurde und auch am nächsten Tage abreisen wollte. Am nächsten Nachmittag traf ich ihn mit Anny kurz vor seiner Abreise nochmal im Bauer (jetzt Glasl). Meine Stimmung war aber infolge der Jenny-Sache nicht zum Poussieren angetan, und so war das Mädel wohl auch den Tag von mir enttäuscht. Jedenfalls hat sie bisher nicht angerufen.
Gestern war die Gräfin wieder bei mir. Morgen will sie sich mit Otto Gross bei mir treffen. Gestern abend – nachdem wir mit Hörschelmann zusammen bei Stobbe gewesen waren – aß ich bei Maaßen Abendbrot. Nachher gingen wir zum Krokodil, wo blos Karl Henckell, Dr. Happe und Wilm saßen. – Als sie gegangen waren, holte uns B. v. Jacobi an einen andern Tisch des Ratskellers, wo Wedekind mit Frau, Lucy v. Jacobi und das Ehepaar Karl Ludwig Schröder saßen. Dieses Ehepaar hatte mich Sonntag abend schon aus der Torggelstube herausgeholt. Der Mann hat jetzt die Regie für eine Kopenhagener Film-Fabrik und sammelt in ganz Deutschland Kientopp-Autoren. Ich unterschrieb ihm einen Vertrag, nach dem ich mich verpflichte, die „Verfilmung“ meiner für den Kienematographen geeigneten Sachen dieser Firma zu übertragen, wofür ich 2 % des Brutto-Verdienstes kriege. Vielleicht ist da also ein Geschäft zu machen.
Von Geheeb ein liebenswürdiges Schreiben: Meine Bewerbung komme zu spät. Dr. Blaich sei bereits anstelle von Dr. Heinrich in die Simpl-Redaktion eingetreten. Wenn er aber etwas geeignetes für mich wüßte, wolle er mir helfen.
Eben war die arme Mary Pfifferle bei mir zum Abendbrot. Sie lebt und hungert mit Kurt Tarrasch zusammen. Ich küßte das arme kranke Mädel tüchtig ab und schenkte ihr 2 Mk, nachdem mir Gotthelf eben im Café 20 Mk gegeben hatte. – Übrigens ist auch Frieda Gutwillig wieder eingetroffen und hat sich ihre Begrüßungsküsse schon geholt. – Aber was habe ich davon? Ich sehne mich nach Jenny, nach ihr allein.
München, Mittwoch, d. 9. Oktober 1912.
Es ist 10 Minuten nach 3 Uhr. Um ½ 3 wollte Gross zu mir kommen, um 3 die Gräfin. Auf Gross rechne ich nicht mehr, auf die Gräfin sicher. Bis sie kommt, ein paar Bemerkungen ins Tagebuch.
Am Balkan ist der Krieg ausgebrochen. Montenegro hat angefangen, die Kriegserklärungen Bulgariens, Serbiens und Griechenlands an die Türkei werden wohl in den nächsten Tagen erfolgen. Worum es sich eigentlich handelt, wird aus den Zeitungen garnicht klar. Diese Leute wissen nur immer vom Episodischen der Ereignisse zu faseln, von den Zusammenhängen haben sie keine Ahnung. Es scheint, als ob die Balkanstaaten die Schwächung der Türkei durch den Krieg mit Italien benutzen wollten, um im Trüben zu fischen. Beschleunigt ist dann ihr Vorgehn offenbar durch die törichte und dilettantische Aktion des österreichischen Ministers v. Berchtold, der namens der europäischen Mächte den Balkanländern die Wahrung ihrer Interessen zusicherte. Dadurch mußte Mißtrauen entstehn, das sich nun in einem wüsten Kriege der Balkanstaaten untereinander entlädt. Das Ende wird wohl wieder der Sieg der Türkei sein und daran anschließend die Expropriation der Türkei durch die Mächte, die in einem Kongreß à la Berlin 1878 die Autonomie Rumeliens und Mazedoniens und Kretas Anschluß an Griechenland verfügen werden. Politik ist schon eine grenzenlose Niedertracht.
Jenny verkündet jetzt mit großer Zuversicht unser Rendezvous, das in 14 Tagen stattfinden soll. Ihre Mutter reist erst in diesen Tagen nach Berlin, und sobald sie mit Onkel Leopold über die Finanzierung unsrer Ehe einig ist – gebe Gott, daß die beiden einig werden! – erhalte ich eine Einladung nach Eydtkuhnen. Jenny reist mir dann, so ist es vorläufig der Plan, nach Berlin entgegen, und vielleicht machen wir es möglich, mal eine Nacht ganz uns allein anzugehören, worauf dann die offizielle Verlobung und alles weitere erfolgt. Ich wollte wirklich, es käme endlich zum Abschluß. Dieses Herumzappeln macht mich nachgrade sehr nervös.
Heut mittag kam ins Stefanie Uli und setzte sich zu mir. Zu meiner Überraschung ließ sie sich den „Figaro“ geben, den sie eifrig studierte. Da sie nicht französisch kann, war ich höchst erstaunt und dann gradezu gerührt, als sie auf meine Frage gestand, sie sehe nur nach, ob vielleicht eine Kritik über Seewald drinstände, der in Paris ausgestellt hat. Ich mußte sehr lachen und sagte: Liebe lehrt französisch.
München, Sonnabend, d. 12. Oktober 1912.
Von Jenny war gestern kein Brief gekommen und ich hatte mich schon sehr geängstigt. Als nun heute früh wieder nichts kam, geriet ich in völlige Verzweiflung und dachte, alles wäre aus. Gottseidank, gegen Mittag kam ein Brief – und was für einer. So lieb, so zärtlich, vergnügt und vertrauend, daß ich nun ganz glücklich und zuversichtlich bin. Wie unsre Angelegenheit im Augenblick steht, darüber fehlt leider immer noch die Erklärung. Jennys Mutter scheint noch nicht abgereist zu sein und wann ich nach Berlin fahre, ist noch ganz unbestimmt. Aber ich hoffe, endlich muß die Sache nun vorwärtsgehn.
Folgende Daten aus den letzten Tagen. Die Gräfin besuchte mich noch einmal vor ihrer Abreise (Gross kam natürlich nicht). Die Berichte über Frieda lauten leider sehr pessimistisch. Die Nerven der armen lieben Frau sind völlig herunter und vor allem fürchtet sie Schweinereien von Otto Gross und noch mehr von dessen Eltern. Ich beruhigte die Gräfin über Otto, der gewiß nichts gegen Frick unternehmen werde, solange er im Gefängnis sei. Schlimm ist nur, daß der arme Kranke durchaus wieder mit Frieda in Beziehung treten will, wovor Frieda natürlich graut. Frieda ist nur deswegen nicht nach München gekommen, um ihn nicht zu treffen. Ihren Kindern geht es gut. Ich denke daran, vielleicht nach meiner Verheiratung sie mal mit Jenny in Ascona zu besuchen.
Mit Maaßen, der sich immer mehr als ein ganz prächtiger Mensch entpuppt, komme ich täglich zusammen. Er ist jetzt mein Hauptverkehr. Gestern haben wir zum erstenmal die Idee unsres Lustspiels ausführlicher besprochen. Jetzt wird es wohl in Zug kommen.
Zwei Theaterabende. Im Volkstheater die Uraufführung von „Bubi“ von Meyrink und Roda Roda. Ich gestehe, daß ich bei der Lektüre des Stücks einen ganz falschen Eindruck gewonnen hatte. Bei der Aufführung zeigte es sich, daß dies „Lustspiel“ eine schlechte Posse ist, über die sich kaum ein Wort verlohnt. Da überdies sauschlecht gespielt wurde, war es eine recht unerquickliche Unterhaltung. Meyrink tat mir leid, als er sich verneigte. In der „Schaubühne“ habe ich drüber geschrieben. Hoffentlich kostet mich die ironische Behandlung der Sache nicht die Freundschaft der Autoren.
Gestern war im Lustspielhaus Premiere. Leonid Andrejews: „Das Leben des Menschen“. Ein Spiel in fünf Bildern. Schon wieder ein Mysterium. Ich meine, man hätte genug davon. Wahrscheinlich liest sich die Sache sehr schön. Auf der Bühne wirkte die mystische Sauce ohne Braten peinlich. Dazu war Roberts Regie, die alle Welt wieder über den grünen Klee lobt, recht dürftig und die Darsteller nur teilweise genügend. Ganz schlecht der Darsteller des „Menschen“, ein Herr Kaiser-Titz und seine Frau, die Roland, die eine Rolle, die für die Höflich geschaffen wäre, zergnautschte und zerjüdelte.
Heut abend muß ich wieder ins Theater: Schauspielhaus-Premiere.
München, Montag, d. 14. Oktober 1912
Die Heiratsangelegenheit geht so langsam vorwärts, daß meine Nervosität immer größer und meine Arbeit immer trüber wird. Der neueste „Kain“ ist direkt langweilig ausgefallen, und alles andre kommt garnicht voran. Vor allem muß ich endlich den Kain-Kalender in Arbeit nehmen, von dem ich noch garnicht weiß, was hineinkommt. Dann soll das Lustspiel steigen, und inzwischen muß ich doch Geld verdienen und weiß garnicht, womit. Gestern half mir H. H. Ewers mit 10 Mk aus. Sind die alle, weiß ich nicht weiter. Meine Hoffnung ist, daß ich sobald wie möglich zum Rendezvous mit Jenny und ihrer Mutter nach Berlin gerufen werde. Das zahlt dann auf meine künftigen Kosten die Familie. Ich bin neugierig, ob ich in diesem Monat nun endlich werde zur Verlobung nach Eydtkuhnen reisen können.
Sonnabend gabs im Schauspielhause Premiere von „Hinter Mauern“, Schauspiel in 4 Akten von dem Dänen Nathansen. Die ersten beiden Akte sind
sehr schön. Judenmilieu, und alles so gesehen und gestaltet, daß man merkt,
dieser Henri Nathansen kennt die Sache genau und selbst, wenn [es] man sie auch kennt, seltsam ergriffen wird. Die Fabel ist wenig belangvoll. Das Problem ist die Niederhaltung der jungen freieren Generation durch die ältere unfreie. Problem: Vater und Kind, verschärft durch Judentum. Also mein Fall, nur viel friedlicher, viel weniger rabiat. Im dritten Akt wird die Komödie leider zum Spektakel, Kientopp, Bataille, im letzten klingt sie sentimental und übel aus. Aber sehr begabt, sehr begabt. Die Aufführung ganz leidlich. Wundervoll wieder die Glümer als alte Judenmutter. Peppler als Vater, sah nicht jüdisch aus und konnte nicht mauscheln. Die Schaffer als Hauptperson, die Tochter, die den Christen heiratet, recht tüchtig. Die Episoden, ausgenommen Randolf, der so scheußlich spielte wie immer, gut und genügend. – Nachher in der Torggelstube große Debatten übers Judentum, wobei ich merkwürdigerweise das konservative Element vertrat und speziell gegen Dr. Rosenthal die Behauptung vertrat, daß immer noch und zwar rechtens und erfreulicherweise ein tiefer innerer Zusammenhang zwischen den Juden besteht. Am Gespräch beteiligten sich Wedekind, der Maler Berneis und H. H. Ewers. Ferner der ekelhafte Friedenthal, der – selbst ein Jude, aus
dem man drei schneiden kann, ein charakterloses Assimilationsprinzip vertrat.
Ich will hier schnell zu Ende kommen. Denn es ist bald 9 Uhr und ich will noch in die Hans-Sachsstrasse, wo ich vermutlich einige kümmerliche Reste der Gruppe Tat finden werde und dann in den Ratskeller zum Krokodil.
Mit Ewers, der seit ein paar Tagen hier ist und morgen wieder abreisen will, war ich gestern den ganzen Tag beisammen. U. a. in der Ausstellung, die gestern abend geschlossen wurde. Wir sahen dort einem Geschicklichkeitsfahrer und einer sehr interessanten Fuchsjagd von Motorradfahrern zu. Diese häßlichen lärmenden Apparate wurden ganz graziös und ihr wildes Knallen, das wie Massenfeuern aus eleganten Revolvern klang, verstärkte die Spannung der Jagd. – Abends bei Benz, wo es entsetzlich fade war.
Heut koitierte ich das dicke Modell Willy, die im zweiten Monat schwanger ist. Sie heißt Willy Fugger, genannt Thoma und hat einen reizenden Busen. Ich hatte sie auf der Straße getroffen und mit heimgenommen. Ihr Galan hat sich von ihr losgesagt und sie behauptet, ich sei im ganzen erst der zweite Mann, mit dem sie sich eingelassen habe. Ob mans glauben darf?
München, Donnerstag, d. 17. Oktober 1912.
Die Eintragungen hier werden immer spärlicher. Das hängt natürlich eng zusammen mit der Nervosität, in die ich durch die zögernde Förderung der Eheangelegenheit versetzt bin. Da jede Eintragung hier mich sehr viel Zeit kostet, will ich künftig nur ganz kurz das Wichtigste notieren.
Für heute folgendes: In der Gruppe Tat kam es Montag zu einem kleinen Eclat. Herr Franz Jung begann erst wüst über Landauer zu schimpfen, und dann auch meine Tätigkeit einer Kritik zu unterziehn. Kindler unterstützte ihn dabei. Ich erklärte, keine Lust zu haben, immer nur im Anklagezustand an den Verhandlungen der Gruppe teilzunehmen und forderte die Kritiker auf, alles was sie von mir verlangten, selbst zu tun. Ich sei nicht die Gruppe und strebe die Autorität nicht an, die man mir dort oktroyieren wolle. Darauf wurde mir berichtet, es sei von vier, fünf Seiten erzählt worden, ich hätte gesagt, ich ginge jetzt nur deshalb so selten zu den Gruppensitzungen, um meine Autorität zu stärken. Ich wies das sehr energisch zurück und erklärte den Urheber des Gerüchts für einen infamen Verleumder. Als Jung dann nochmal darauf zurück kam und ich aus seinen Worten heraushörte, daß er immer noch an die Wahrheit der Erzählung glaubte, erklärte ich, mit dieser Gruppe, der es an der ersten Voraussetzung: Solidarität untereinander so gänzlich fehle, nicht weiter arbeiten zu können und daß ich nicht wiederkommen werde. Darauf ging ich. Später im Krokodil waren unter andern Halbe und Wedekind, mit denen ich dann noch in die Weinstube Michl ging. Es ist eine etwas delikate Aufgabe, zwischen den beiden immer noch argwöhnischen alten Freunden zu sitzen. Man trägt dabei die ganzen Kosten des Gesprächs. Gestern war Wedekind zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder auf der Kegelbahn, und dann seit 7 Jahren zum ersten Mal im „Simplizissimus“.